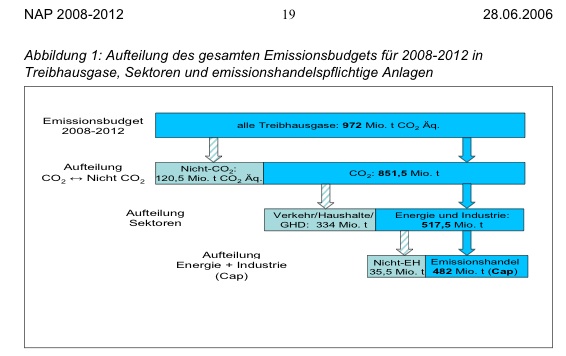Frankfurts Masterplan Mobilität: Eine Autofreie Zukunft oder ein Verkehrskatastrophenrisiko?
Nach der Kommunalwahl 2021 in Frankfurt, einer Stadt mit knapp 750.000 Einwohnern und den fünftgrößten Innenstadtgebiet Deutschlands, hat sich eine Grün-SPD-FDP-Koalition zusammengetan. Diese Koalition hat einen umfangreichen Masterplan Mobilität entwickelt, der die Reduzierung des Autoverkehrs bis 2035 auf ein Minimum beschränken will und knallharte Maßnahmen gegen Autofahrer vorsieht.
Der Vizebürgermeister Wolfgang Siefert (Grüne), verantwortlich für die Umsetzung dieses Plans, behauptet, dass alle Maßnahmen wissenschaftlich belegt seien. Doch selbst wenn es um den Klimaschutz und eine attraktivere Stadt geht, fragen sich viele Einwohner, ob diese Maßnahmen realistisch sind.
Der Masterplan sieht vor, dass 80 Prozent aller Reisen bis 2035 zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden sollen. Um dies zu erreichen, soll der Raum für Radwege stark ausgeweitet und der Parkraum für Autos drastisch reduziert werden. Zudem sollen neue Tempo-Limits von 20 bis 40 km/h eingehalten werden.
Ein Beispiel dafür ist der Grünburgweg im Westend von Frankfurt, wo eine Fahrradstraße eingerichtet wurde, die mit Hunderten von Verkehrsschildern versehen ist. Dieser Umstand bringt jedoch nicht nur technische Herausforderungen, sondern auch praktische Probleme für Einwohner und Geschäftsleute, wie der bekannte Verkehrsrechtsexperte Uwe Lenhart zu BILD erklärt: „Die unzähligen Schilder sind so verwirrend, dass das Ordnungsamt täglich eingreifen muss.“
Ähnliche Veränderungen sind in anderen Städten wie Paris und Berlin bereits sichtbar. In Paris plant man z.B., 500 Straßen zu Fußgängerzonen umzuwandeln. Dies schlägt jedoch nicht nur eine Vielzahl von Herausforderungen für Einwohner und Geschäftsinhaber entgegen, sondern wirft auch Fragen nach der tatsächlichen Effektivität dieser Maßnahmen auf.
Ein Buchhändler aus Frankfurt berichtet: „Viele ältere Kunden steigen nicht aufs Fahrrad um und kaufen stattdessen im Main-Taunus-Zentrum ein. So stirbt eine Kultur, und mit ihr ein Teil der Stadt.“ Diese Aussagen weisen darauf hin, dass die Maßnahmen möglicherweise mehr Schaden als Nutzen anrichten.