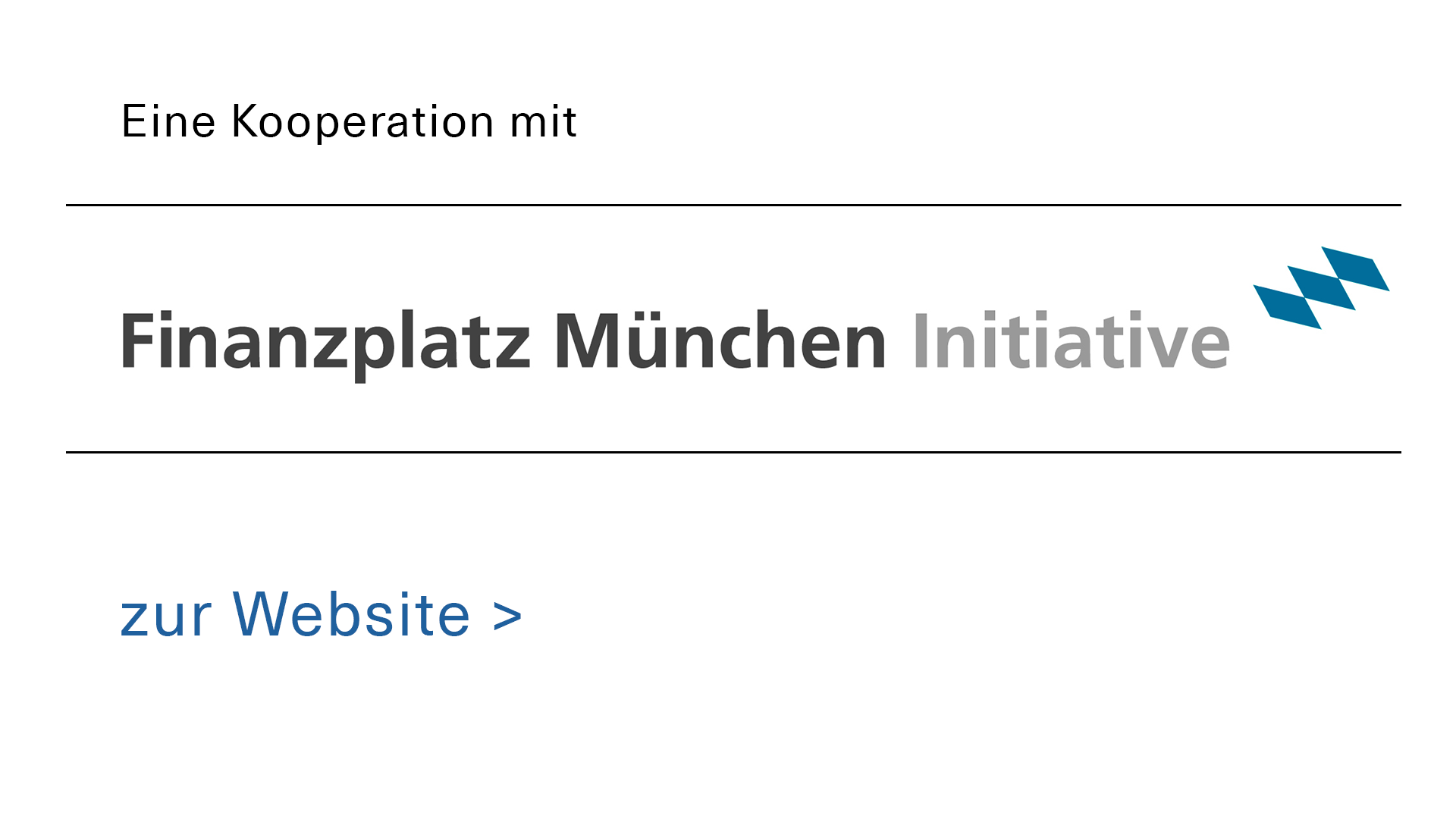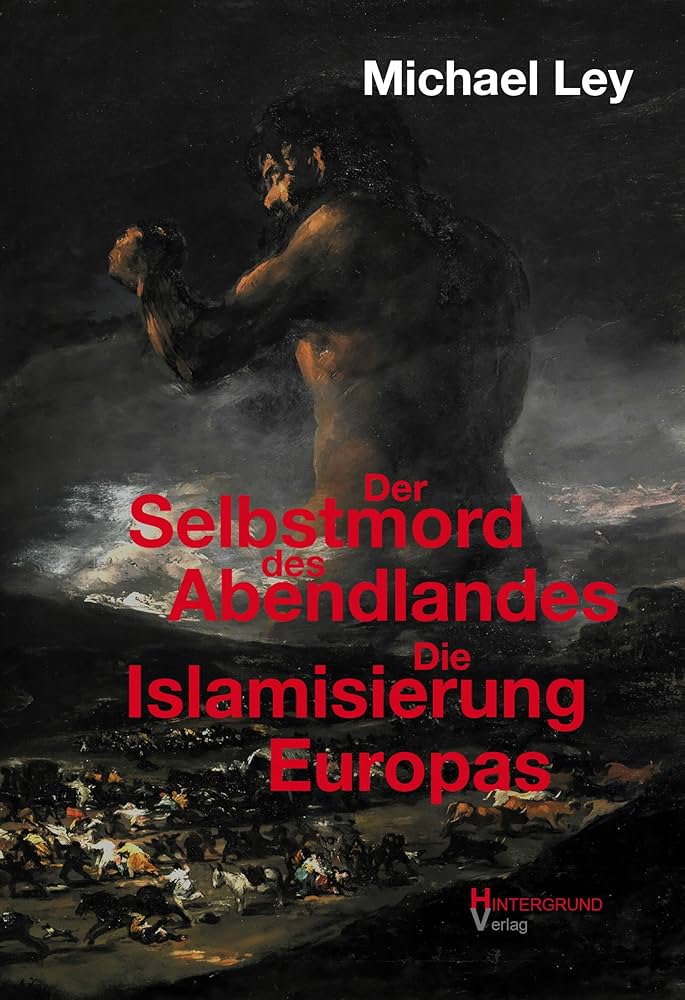Koalitionspläne zur Bekämpfung von Steuerbetrug durch digitale Zahlungen
In den laufenden Koalitionsverhandlungen haben die Union und SPD neue Maßnahmen zur Verbesserung der Einnahme von Umsatz- und Gewinnsteuern in bargeldintensiven Branchen wie Gastronomie und Handel diskutiert. Sie planen, den Einsatz von elektronischen Bezahlmöglichkeiten für Unternehmen zu erzwingen, um Steuerbetrug zu bekämpfen und den Nachteil steuerbegünstigter Gewerbetreibender gegenüber ihren steuerehrlichen Konkurrenten zu verringern.
Michael Schrodi, Finanzexperte der SPD, betonte in seiner Rede vor dem Abstimmungstermin zur Abschaffung der Schuldenbremse die Notwendigkeit einer allgemeinen Registrierkassenpflicht. Nach Berechnungen der Expertengruppe könnten jährlich 10 bis 15 Milliarden Euro an Umsatz- und Gewinnsteuern sowie zusätzliche Lohn- und Sozialabgaben verloren gehen, wenn nicht drastischere Maßnahmen ergriffen werden. Dies würde den Gesamtschaden auf bis zu 70 Milliarden Euro pro Jahr belaufen.
Die Koalitionspartner argumentieren, dass diese neuen Steuerregeln zur Schutzrechnung für die steuerehrlichen Unternehmer dienen sollen und eine echte Wahlfreiheit im Zahlungsverkehr fördern würden. Allerdings wird von Experten bezweifelt, ob der erwartete Gesamtumfang der verlorenen Steuererträge realistisch ist oder ob die zusätzlichen Kosten für Unternehmen gerechtfertigt sind.
Zusätzlich kritisieren Kritiker den Fokus auf die Bekämpfung des Steuerbetrugs gegenüber anderen potentiellen Einsparungen in den Staatshaushalt, wie z.B. durch Einschränkung von Subventionen für erneuerbare Energien, Entwicklungshilfe und Migration.
Die neue Regelung würde nicht nur zu höheren Kosten für Unternehmen führen, sondern auch den Konsumenten die Freiheit des Bargeldzahls entziehen. Banken verlangen etwa 0,3 Prozent pro Transaktion bei EC-Karten und bis zu drei Prozent bei Kreditkarten, was zusätzliche Belastungen für das Geschäft bedeutet.
Der Artikel deutet an, dass es sich bei den Branchen, die noch ohne digitale Zahlungsmethoden arbeiten, um einen sehr kleinen Kreis mit vermutlich niedrigem Umsatz handelt. Daher könnten die in Frage stellten 70 Milliarden Euro als unrealistische Schätzung betrachtet werden.