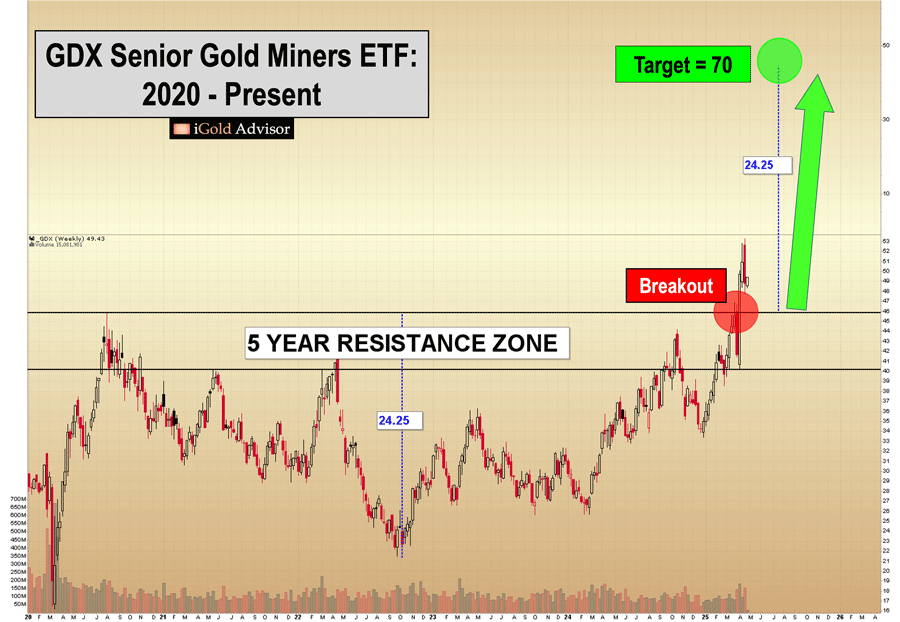Ermittlungen der Bundesnetzagentur zur Dunkelflaute
Die Bezeichnung „Dunkelflaute“ hat ihren Weg in den englischen Sprachgebrauch gefunden, ebenso wie mancher anderer deutscher Ausdrücke, die sich in die internationale Sprache eingeschlichen haben. In anderen Ländern wird der Begriff eher ignoriert, da Windstille und Dunkelheit in der Regel mit Wetterbedingungen assoziiert werden und nicht mit der Zuverlässigkeit der Energieversorgung. In Deutschland hingegen, wo der Übergang zu erneuerbaren Energien als eine Staatsaufgabe betrachtet wird, werden solche Wetterphänomene schnell zum Anlass für Schuldzuweisungen.
Der Titel könnte leicht missverstanden werden. Es geht nicht darum, gegen die Windstille zu ermitteln, sondern um die Auswirkungen, die sie auf die Energieversorgung hat. Gelegentlich stellen die dunklen und windstillen Tage eine Herausforderung für die deutsche Energiewende dar. Dies geschah schon in der Vergangenheit, beispielsweise an den Tagen um den 6. November, 12. Dezember und 27. Dezember 2024, und auch in den ersten beiden Monaten des Jahres 2025 sind Wetterbedingungen zu erwarten, die die Windstromproduktion weiter beeinträchtigen werden.
In einem Artikel auf finanzmarktwelt.de wird berichtet, dass Windkraftbetreiber in eine ernste Krise geraten. Von Anfang Januar bis Mitte Februar fiel die Produktion von Windstrom im Vergleich zum Vorjahr um rund 28 Prozent. Die Frage, wie man einem derart unbeständigen Stromlieferanten eine wesentliche Rolle für die „nationale Sicherheit“ oder das „öffentliche Interesse“ zuschreiben kann, ist schwer nachzuvollziehen. Sichtbar wird dies insbesondere durch den Einfluss der Windlobby, repräsentiert durch die Grünen, die kürzlich an der Regierung beteiligt waren.
Parallel zu den Ereignissen in Bezug auf Windkraft reagierten auch die Großhandelspreise. Am Spotmarkt traten am 11. Dezember und am 12. Dezember Rekordpreise von über 1.000 Euro pro Megawattstunde auf. Diese Preisanstiege wurden durch hohe Importmengen von Strom aus anderen europäischen Ländern verschärft, was zu Verärgerung und Kritik insbesondere aus Schweden und Norwegen führte.
Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat in Reaktion auf die Situation angekündigt, potenziellen Marktmanipulationen der Kraftwerksbetreiber auf den Grund zu gehen. Es wird vermutet, dass einige Betreiber durch Zurückhaltung von Kapazitäten versucht haben, die Preise zu steigern. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen, die nun schon seit mehrere Wochen andauern, stehen jedoch noch aus, und die Behörde hat lediglich erklärt, dass sie noch nicht abgeschlossen sind.
Schnellere Antworten lieferte jedoch Stefan Spiegelsberger, ein Energiejournalist, der umgehend relevante Informationen zu den nicht verfügbaren Kraftwerken und deren Ursachen bereitstellte. Zudem stellte sich heraus, dass eine Reihe von Kraftwerkskapazitäten nicht aktiviert werden konnte, da sie als Notreserve eingestuft sind und nur im Ernstfall eingesetzt werden dürfen. Daher waren diese zur Verfügung stehenden Quellen innerhalb der Dunkelflauten nicht im Spiel, was einen preissenkenden Effekt verhindert hat.
Die Lage wird sich in der Zukunft voraussichtlich nicht entspannen, ganz im Gegenteil. Viele Kohlekraftwerke sind zum Stillstand verurteilt, was zu einer weiteren Reduzierung der verfügbaren Kapazitäten führt. In Anbetracht der Gesetzgebung wird bis zum endgültigen Stilllegungsdatum kein nennenswerter Investitionsbedarf gedeckt, was das Risiko steigender Ausfälle erhöht.
Die Folgen von Dunkelflauten sind nicht zu unterschätzen. Die Preise könnten weiter steigen, während die Netzsicherheit nicht beeinträchtigt ist – noch nicht zumindest. Während der Präsident der Bundesnetzagentur die Risiken und möglichen Notfallmaßnahmen diskutiert, bleibt abzuwarten, welche Verantwortlichen ins Visier genommen werden, wenn die Auswirkungen von unvorhersehbaren Energielieferungen noch erheblichere Formen annehmen sollten.
Diese Entwicklungen verdeutlichen, wie die Herausforderungen der Energiewende zu einem zentralen Thema der deutschen Energiepolitik geworden sind und welche Schwierigkeiten mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen verbunden sind.