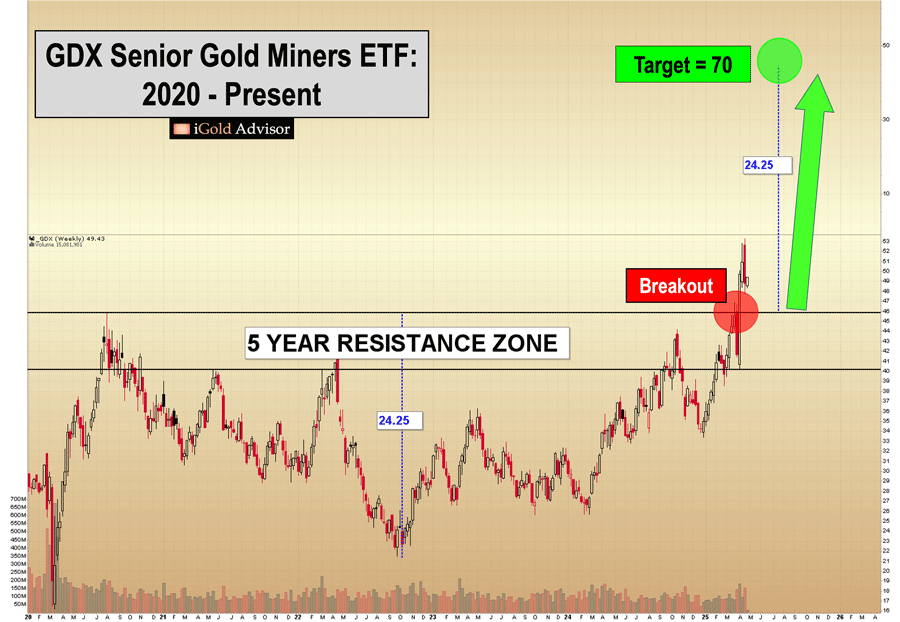Mercedes-Benz verzeichnet dramatischen Gewinneinbruch und unsichere Zukunft der Elektrostrategie
Im letzten Jahr sah sich der Stuttgarter Autohersteller Mercedes-Benz mit einem signifikanten Rückgang seines Gewinns konfrontiert. Dies wurde durch eine offizielle Mitteilung des DAX-Konzerns bekannt gemacht. Entscheidenden Einfluss auf die negative Entwicklung hatte die Elektrostrategie, die sowohl im deutschen als auch im chinesischen Markt nicht die erwarteten Ergebnisse lieferte.
Für das Jahr 2024 meldete Mercedes einen Gewinnrückgang von erstaunlichen 28 Prozent, wodurch das Konzernergebnis auf 10,4 Milliarden Euro fiel. Auch der Umsatz erlebte einen Rückgang von 4,5 Prozent auf 145,6 Milliarden Euro. Ein zentraler Grund für die Minderung des Erfolgs ist die anhaltende Absatzkrise des Unternehmens, das weltweit nur rund 2,4 Millionen Fahrzeuge absetzen konnte – eine Reduzierung um 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders die Pkw-Sparte von Mercedes-Benz Cars hatte zu kämpfen und erlebte einen Rückgang um 3 Prozent auf 1,98 Millionen verkaufte Einheiten.
Besorgniserregend ist die dramatische Entwicklung auf dem chinesischen Markt, der als entscheidender Absatzmarkt für den deutschen Autohersteller gilt. Die Verkäufe in China gingen laut Statista im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent zurück. Auch in Europa sah sich der Konzern mit einem Rückgang von 2,8 Prozent konfrontiert. Hauptverantwortlich für die Rückgänge sind die enttäuschenden Verkaufszahlen der Elektrofahrzeuge, die sich massiv auf die Bilanz auswirken. Insgesamt konnte Mercedes nur 185.100 vollelektrische Fahrzeuge absetzen, was gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von 23 Prozent entspricht. Der dramatischste Rückgang wurde im vierten Quartal mit einem Minus von 26 Prozent verzeichnet.
Die Gründe für die Schwierigkeiten deutscher Elektroautos auf dem chinesischen Markt sind vielschichtig. Erstens haben die heimischen Hersteller einen klaren Vorteil durch staatliche Subventionen und günstigere Produktionskosten, während die deutschen Automobilhersteller mit deutlich höheren Ausgaben kämpfen müssen. China ist der führende Akteur beim Zugang zu entscheidenden Rohstoffen wie Lithium, was es den lokalen Herstellern ermöglicht, Elektrofahrzeuge zu deutlich niedrigeren Preisen anzubieten.
Zweitens wird der chinesische Automarkt durch eine schwächelnde Wirtschaft belastet. Trotz eines BIP-Wachstums von 5 Prozent im Jahr 2024, das im globalen Kontext als positiv gilt, bleibt es im historischen Vergleich eher schwach. Hohe Preismarken der deutschen Fahrzeuge stehen in starkem Wettbewerb zu den günstigeren Modellen chinesischer Hersteller, was den Absatz unter Druck setzt.
In Deutschland hat der Rückgang der Neuzulassungen von E-Autos viel mit dem Wegfall des Umweltbonus zu tun, der maßgeblich zur Schaffung einer künstlichen Nachfrage beigetragen hatte. Seit 2016 unterstützte der Staat Käufer finanziell durch Subventionen, die bis 2023 insgesamt 10 Milliarden Euro ausmachten. Mit dem Wegfall dieser Anreize zeigte sich das tatsächliche Interesse der Verbraucher als geringer, als vielfach angenommen.
Zusätzlich zur finanziellen Unterstützung ist die ungleiche Verteilung der Ladeinfrastruktur ein Problem. Während Deutschlands 130.000 öffentliche Ladepunkte im Verhältnis zu 1,7 Millionen zugelassenen Elektrofahrzeugen weit unter dem Bedarf liegen, zeigen Berechnungen, dass bis 2030 rund 450.000 zusätzliche öffentliche Ladepunkte erforderlich wären.
Angesichts dieser Herausforderungen sieht sich Mercedes gezwungen, einen Sparkurs einzuleiten. Der Konzern plant Maßnahmen zur Steigerung seiner Wettbewerbsfähigkeit und kündigte an, bis 2027 die Produktionskosten um 10 Prozent zu senken. Dies umfasst auch Einschnitte bei den Prämien für Mitarbeiter und möglicherweise sogar Stellenabbau, obwohl derzeit keine offiziellen Daten dazu vorliegen.
Die unhaltbaren Rahmenbedingungen für die deutsche Automobilindustrie, einschließlich hoher Energiekosten und strenger Bürokratie, zwingen viele Unternehmen zur Verlagerung ihrer Produktion ins Ausland. Mercedes-Benz investiert etwa 1,5 Milliarden Euro in den Ausbau seines Werkes in Kecskemét, Ungarn. Die geringen Betriebskosten in Osteuropa, die um 70 Prozent unter den deutschen Kosten liegen, machen die Verlagerung attraktiv. In diesem neuen Werk sollen sowohl Elektro- als auch Hybridfahrzeuge sowie traditionelle Modelle gefertigt werden.
Die Entscheidung, nach Ungarn zu expandieren, könnte in Berlin auf Widerstand stoßen, insbesondere vor dem Hintergrund der bestehenden politischen Spannungen zwischen der EU und der ungarischen Regierung unter Viktor Orbán. Trotz kritischer Einschätzungen in den deutschen Medien erfreut sich Orbán jedoch einer hohen Zustimmung in seiner Heimat.
Die Herausforderungen stehen Mercedes-Benz vor, während der globale Wettbewerb und ein schwächelnder Absatzmarkt Druck ausüben. Vor allem die hohe Preisgestaltung und die strengen Richtlinien der EU belasten die deutschen Hersteller weiter, die sich nun besser positionieren müssen, um im internationalen Markt bestehen zu können.
Die Situation ist für die deutsche Automobilindustrie alarmierend. Jene Unternehmen, die weiterhin in Deutschland produzieren wollen, müssen sich entweder auf etliche Herausforderungen im Markt einstellen oder nach neuen Lösungen zur Kostensenkung und stärken ihrer Wettbewerbsfähigkeit suchen, um sich in einem sich schnell verändernden Markt zu behaupten.