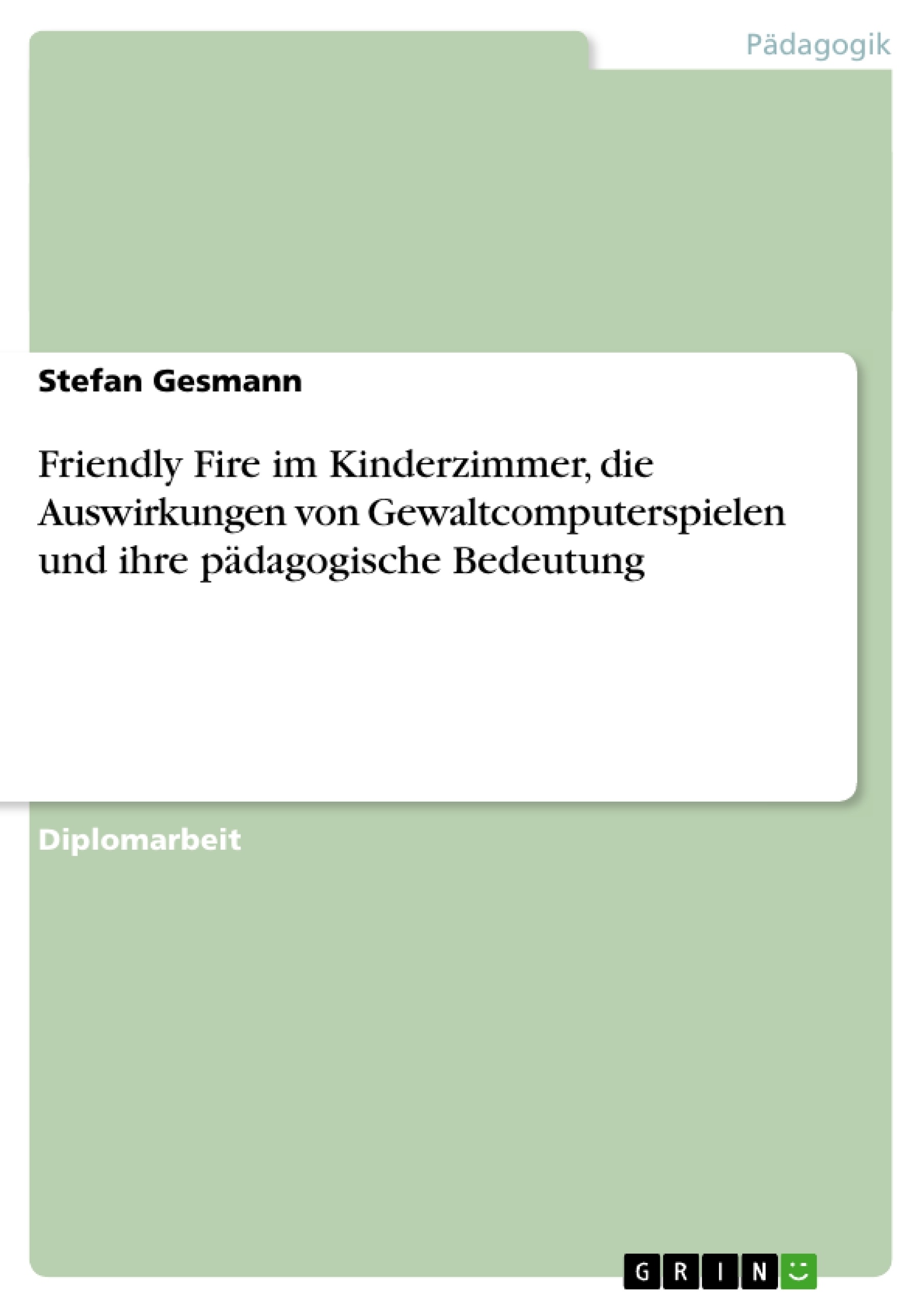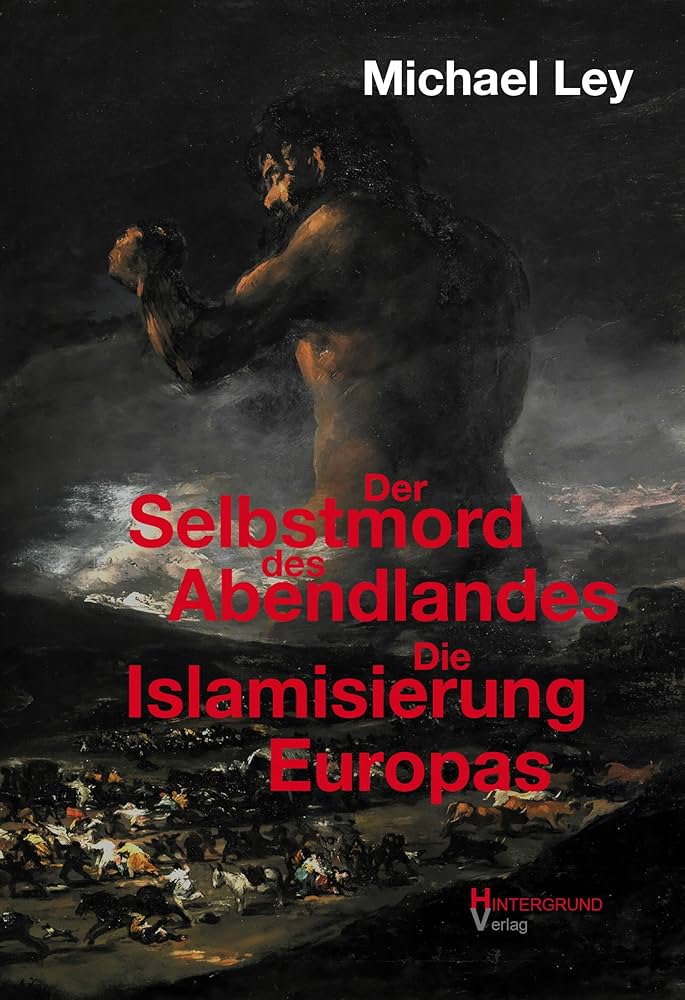Eine verzweifelte Rache: Wenn Vernichtung zum Ziel wird
Der Konflikt zwischen Israel und Palästina erfordert einen Blick durch die Linse der Konfliktpsychologie. In diesen schwierigen Auseinandersetzungen entsteht oft eine Eskalationslogik, die nicht nur brutal ist, sondern auch durch ihre eigene Dynamik angetrieben wird.
Stellen Sie sich eine Szene vor: Nach einem heftigen Streit wendet sich eine Frau an ihren Partner und sagt voller Verzweiflung: „Lass uns endlich mit dem Wahnsinn aufhören, Schatz!“ Daraufhin erwidert der Mann in wütendem Ton: „Jetzt fängst du schon wieder an!“ Konflikte neigen dazu, sich in zerstörerische Strukturen zu verfangen, aus denen die Betroffenen kaum entkommen können. Außenstehende können oft nur den Kopf schütteln.
Die kritische Phase in einer Konfliktdynamik wird erreicht, wenn eine Seite derart vom Gedanken besessen ist, der anderen Partei Schaden zuzufügen oder sie zu vernichten, dass sogar die Aussicht auf eigene Selbstzerstörung in Kauf genommen wird. In einer derartigen Rache-Eskalation fühlt man sich sogar schuldig, wenn man dem anderen nicht schadet. Die eigene moralische Rechtfertigung lässt einen nicht erkennen, dass man selbst Teil des Problems ist. „Wir wurden gegen unseren Willen in diesen Konflikt hineingezogen. Daher tragen die anderen die volle Schuld an all der Zerstörung.“
Diese Tatsache kann dazu führen, dass Konflikte bis zur gnadenlosen Zerstörung von Familien, Unternehmen, politischen Parteien oder sogar ganzen Staaten eskalieren. In anderen Lebensbereichen können dieselben Menschen fürsorglich und verantwortungsbewusst sein, doch im Sumpf schwerer Kränkungen und Verletzungen scheinen alle ihre humanen Seiten zu verlieren. Der Gegner wird dann dämonisiert, und gegen einen solchen Dämon erscheinen alle Mittel als gerechtfertigt.
Am 7. Oktober 2023 trat der Gaza-Israel-Konflikt offenbar in diese finale Eskalationsstufe ein. Selbst eine massive Mauer, die die beiden Konfliktparteien trennte, konnte dieser Dynamik nicht entgegenwirken. Sie wurde überwunden, nicht um Frieden zu suchen, sondern um an Israel Rache zu üben und möglichst viele Menschen sinnlos zu töten. Eine große Mehrheit der Gazabewohner zeigt sich euphorisch in ihren Rachegelüsten, bereit, den Preis der Selbstzerstörung zu akzeptieren, den der daraus entstandene Terrorismus mit sich bringt. Sie glauben, dass sie durch ihre blutigen Taten die Schuld ablegen können, die sie auf sich laden, wenn sie den vermeintlich schuldigen Gegner unbehelligt lassen. Selbst die Rückgabe tote Geiseln wird strategisch so inszeniert, dass sie den Juden Schmerz bereitet.
Die Selbstzerstörung wird nicht als Nachteil empfunden, da man sich von Gott und dem Prinzip der Gerechtigkeit unterstützt glaubt. Gewalttaten und der Ausruf „Allahu akbar!“ sind dabei eng miteinander verknüpft. Der muslimische Glaube spielt eine zentrale Rolle bei der Akzeptanz dieser Konfliktdynamik, indem er die Akteure motiviert, alle Belastungen auf sich zu nehmen. Sie kämpfen irdisch für Gerechtigkeit und erwarten, dafür im Jenseits geehrt zu werden. Hier gehen Psychologie und Theologie einher.
Wenn sich eine ganze Bevölkerung vom Prinzip der gerechten Rache leiten lässt und dabei die Selbstzerstörung leichtfertig in Kauf nimmt, stellen sich für Außenstehende wie Deutschland zwei Fragen:
Die fortgeschrittene Eskalation der Konfliktdynamik ist offensichtlich, sodass jede Verdünnung des Konfliktes mit wohlmeinenden Ansätzen nicht mehr glaubwürdig ist. Alle Hilfsmaßnahmen für Entwicklung und Flüchtlinge sind unter den gegebenen Umständen letztlich nichts als eine Unterstützung für weiteres Töten und Sterben.
Wo steht Israel in dieser komplexen Dynamik? Das ist unklar. Doch solange zwei Millionen Araber in Israel im Vergleich zu den acht Millionen Juden in Freiheit und Sicherheit leben können, ist Israel insgesamt nicht in der letzten Eskalationsstufe. Die jüdisch-arabische Bevölkerung in Israel hat zudem eine so vielfältige und pluralistische kulturelle, religiöse und politische Landschaft, dass unterschiedliche Meinungen und Positionen demokratisch miteinander diskutiert werden und Raum für Veränderung schaffen.
Da die Bevölkerung im Gazastreifen und die jüdisch-arabische Gemeinschaft in Israel sich in unterschiedlichen Phasen der Konfliktdynamik befinden, ist es nicht gerecht und passend, beide Seiten diplomatisch gleich zu behandeln.