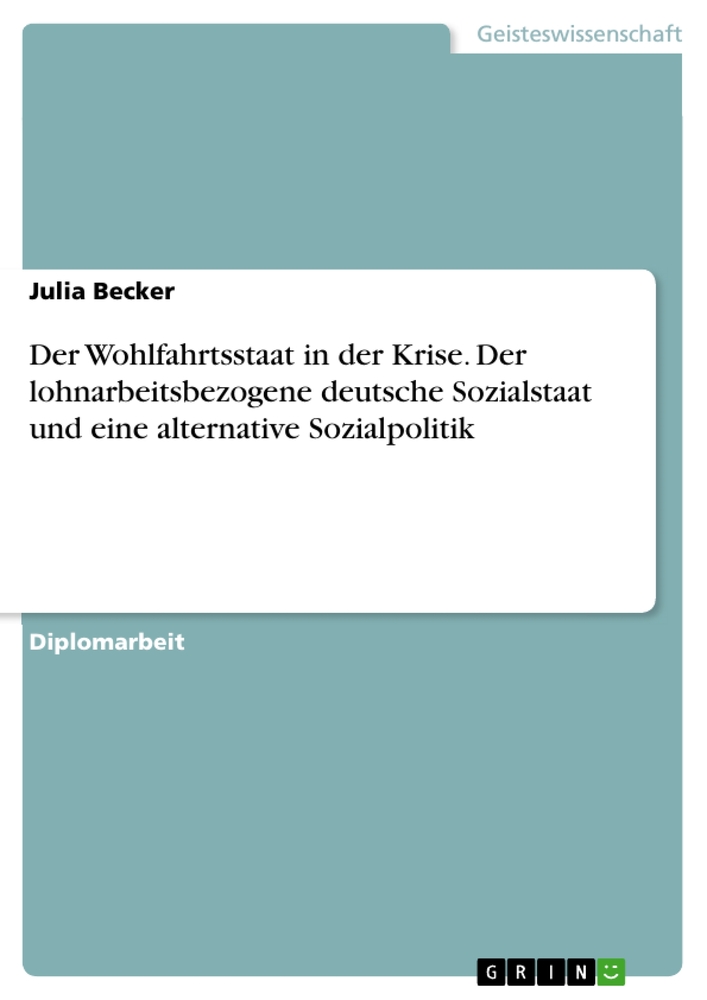Der Verfall des europäischen Wohlfahrtsstaats
In den letzten Jahren haben europäische Politiker zunehmend auf die Strategie zurückgegriffen, externe Feindbilder, wie etwa Donald Trump oder J.D. Vance, heranzuziehen, um von den tiefgreifenden Problemen in ihren eigenen Systemen abzulenken. Der einst als Errungenschaft gefeierte Wohlfahrtsstaat hat sich in Wirklichkeit als Werkzeug erwiesen, um Bürokratien aufzublähen und eine abhängige Unterschicht zu schaffen.
Ursprünglich als ein tragfähiges Konzept gedacht, war der Wohlfahrtsstaat niemals wirklich nachhaltig. Er wurde vielmehr als ein finanziell tragbarer Luxus konzipiert, der nur in Zeiten wirtschaftlichen Wachstums und durch einen produktiven Sektor gedeihen konnte. Doch die Regierungen in Europa haben versäumt, die Bedeutung von wirtschaftlichem Wachstum und Produktivität zu erkennen und zu fördern.
Mit dem Anstieg des Linkspopulismus in allen politischen Lagern wurden fortlaufend neue „soziale Rechte“ eingeführt. Das, was zunächst als soziale Absicherung gedacht war, entpuppte sich rasch als Spirale von Subventionen und Ansprüchen, die die Schaffung von Wohlstand in den Hintergrund drängte. Der Fokus Europas liegt heute vorwiegend auf Umverteilung, während der Aufbau wirtschaftlicher Stärke vernachlässigt wird.
Über die Jahre hinweg wurde der produktive Sektor durch stetig steigende Steuern, erdrückende bürokratische Hürden und regulatorische Maßnahmen zunehmend stranguliert. Gleichzeitig expansierten die Staatsausgaben in einem unkontrollierbaren Maße.
Aktuell beobachtet die europäische Wirtschaft ein gegenläufiges Wirtschaftsmodell: Das Hauptaugenmerk liegt auf Sozialausgaben, die als Grundlage der Wirtschaftspolitik betrachtet werden, während gleichzeitig der private Sektor, der eigentlich diese Ausgaben ermöglichen sollte, geschwächt wird. Dabei bleibt folgendes Faktum bestehen: Ohne eine florierende Wirtschaft kann es keine echte Wohlfahrt geben.
Politiker müssen endlich verstehen, dass Sozialprogramme nicht aus einem angeschlagenen Privatsektor finanziert werden können. Genau dies geschieht jedoch: Eine schrumpfende, überlastete Wirtschaft muss die Kosten eines expandierenden Sozialstaates tragen. Aktuellen Schätzungen von Eurostat zufolge liegt das Verhältnis der Rentenverpflichtungen der Sozialversicherung zum BIP in europäischen Volkswirtschaften zwischen 200 und 400 Prozent.
Diese untragbaren finanziellen Verpflichtungen sind so groß, dass sie nur noch mit einer massiv abgewerteten Währung beglichen werden können, wenn die aktuelle Politik weiterhin Bestand hat. Ein besonders eindringliches Beispiel für den Fehlentwicklungen zeigt sich in Frankreich.
Spielerisch versuchen Politiker, sich aus dieser misslichen Lage herauszuwinden. Der ständig wiederkehrende Kreislauf von Umverteilung und wachsenden Steuerlasten hemmt effektives Wachstum, Investitionen und Produktivität. Sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer verlieren jeglichen Anreiz, da es nahezu unmöglich geworden ist, unter der Last von Bürokratie und Besteuerungen erfolgreich zu agieren.
Präsident Macron bezeichnet die finanzielle Situation Europas als „unterfinanziert“, was jedoch irreführend ist. Tatsächlich haben die europäischen Staaten riesige unfinanzierte Verpflichtungen, die die Haushalte schwer belasten.
Die Frage bleibt: Gibt es Lösungen für dieses Problem? Offenbar traut sich keine Partei, die notwendigen Reformen anzugehen. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Tausende Parteimitglieder sind auf staatliche Posten angewiesen und halten somit am Status quo fest.
Das Ausmaß der Krise ist so gravierend, dass viele europäische Länder nicht einmal in der Lage sind, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen, obwohl sie sich der dringenden Notwendigkeit bewusst sind. Der Wohlfahrtsstaat in Europa dient nicht mehr dem Wohl der Bürger, sondern ist zu einem Werkzeug zur Erhaltung des Staates selbst geworden – und dies geschieht auf Kosten der Unternehmen und der Steuerzahler.
Europa verfügt über erstklassiges Humankapital und innovative Unternehmer. Doch dieses Potenzial wird von einer politischen Klasse gefährdet, die lieber Inflation und Währungsabwertung akzeptiert, als ihren Einfluss auf die Wirtschaft zu verringern.