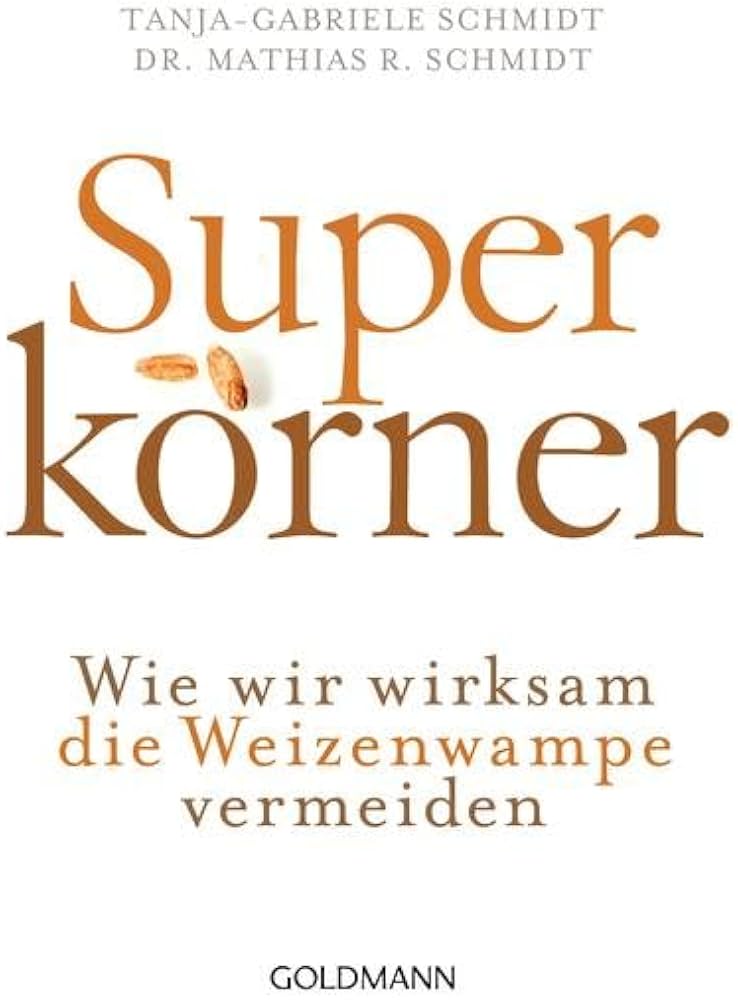Während sich im politischen Diskurs derzeit eine neue Runde an Forderungen nach einem Tempolimit auf den deutschen Autobahnen abzeichnet, richten sich wiederholt kritische Stimmen gegen diese Maßnahmen. Wolfgang Stötzle und Ralf Leiter aus dem Bundesfachausschuss Mobilitätspolitik der WerteUnion gehen in ihrem Artikel tiefgreifend auf die Argumente ein, welche sich hinter diesen Forderungen verbirgen.
Die Diskussion über Tempolimits ist keine neue Angelegenheit. Bereits seit den Anfängen des deutschen Autobahnnetzes sind Verkehrsexperten und Politiker mit verschiedenen Begründungen für eine Reduzierung der Geschwindigkeiten auf die Fahrbahnen gekommen: von Spritverbrauch über Sicherheitsaspekte bis hin zu klimapolitischen Implikationen. Heute wiederholen sich viele dieser Argumente, wobei ein Hauptpunkt darin besteht, dass eine generelle Begrenzung der Geschwindigkeit auf 130 km/h den Klimaschutz fördern sollte.
Zuallererst jedoch wird in dem Artikel darauf hingewiesen, dass bereits etwa 70 Prozent des Autobahnnetzes mit Tempolimit begrenzt sind. Im Rest von 30 Prozent der Strecken gilt freie Fahrt – unter Ausschluss von Baustellen und anderen Belastungen, die zu niedrigeren Durchschnittsgeschwindigkeiten führen. Daten aus einer Studie des Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) zeigen, dass nur etwa 10 Prozent der Fahrzeuge auf diesen unbegrenzten Strecken mit mehr als 150 km/h unterwegs sind.
Ein weiterer Punkt im Artikel betrifft die Frage nach der tatsächlichen Sicherheitssteigerung durch Tempolimits. Die Autobahnen gelten generell bereits als eine der sichersten Straßentypen in Deutschland. Um ein Tempolimit für die gesamte Strecke zu rechtfertigen, müsste gezeigt werden, dass gerade auf den unlimitierten Abschnitten eine besonders hohe Unfallhäufigkeit vorliegt – was bisher nicht nachgewiesen wurde.
Weiterhin wird im Artikel darauf hingewiesen, dass die Argumentation für Tempolimits oft ideologisch motiviert ist und keine realen Vorteile bietet. Zum Beispiel soll das Tempobedingte Senken des Spritverbrauchs als Argument herhalten – eine These, die in den 1970er Jahren populär war, aber heute kaum noch Bestand hat, da der Spritverbrauch durch schnelleres Fahren selbst getragen wird und nicht auf Kosten der Gesellschaft belastet.
Schließlich kritisiert der Artikel auch die Begründung aus Sicht des Klimaschutzes. Zwar ist ein generelles Tempolimit von 130 km/h laut Studien nur um den Bruchteil eines Prozents der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland relevant, während andere Aktivitäten wie kriegerische Aktionen viel mehr Emissionen verursachen. Die Verantwortlichen für die Forderung nach Tempolimits könnten damit ein verborgenes Ziel haben: das Auflösen des sichtbaren Unterschiedes zwischen Elektrofahrzeugen und Verbrennungsmotoren zu fördern, um den E-Fahrzeuganteil indirekt zu erhöhen.
Insgesamt bleibt die Frage offen, ob eine allgemeine Verordnung eines Tempolimits auf 130 km/h mehr als einen rein populistischen Ansatz darstellt und keinen substantiellen Beitrag zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit oder dem Klimaschutz leisten kann.