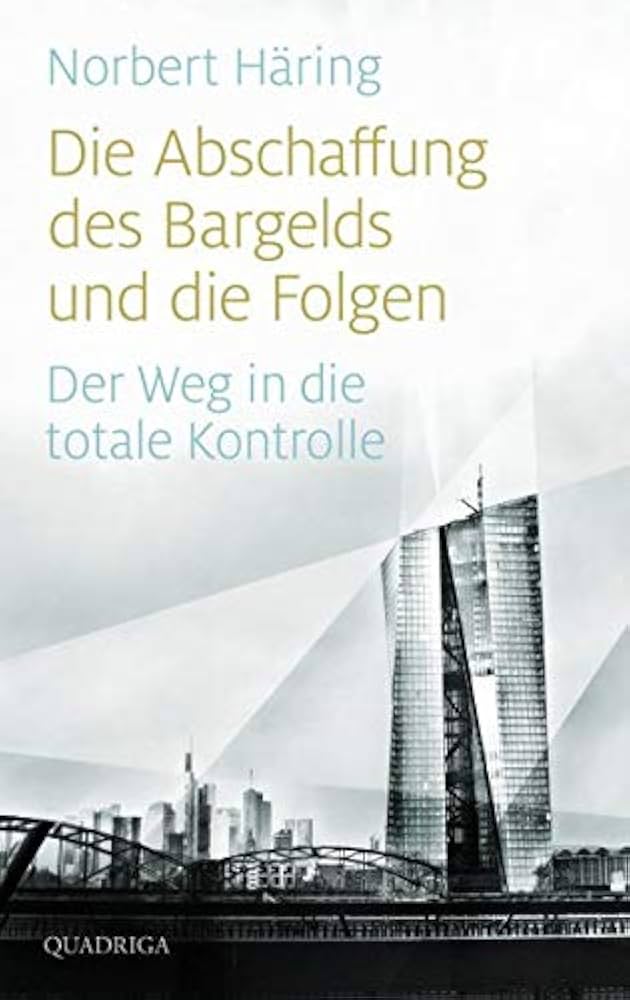Seit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus werden Spekulationen verstärkt, dass seine zweite Amtszeit das Ende des internationalen Spionagenetzwerks Five Eyes bedeuten könnte. Dieses Netzwerk, bestehend aus Australien, Großbritannien, Kanada, Neuseeland und den USA, überwacht die öffentliche und private Kommunikation der gesamten Weltbevölkerung. Im Februar berichtete die Financial Times, dass Peter Navarro, ein wichtiger Berater Trumps, darauf drängt, Kanada aus Five Eyes zu entlassen. Dies löste unter westlichen Geheimdienstexperten Befürchtungen aus, dass der Ausschluss Ottawas den Zusammenbruch des Netzwerks beschleunigen könnte.
Im April fragte das britische Magazin The Economist: „Könnte Donald Trump den Spionagepakt Five Eyes gefährden?“ Politico stellte im März die Frage, ob Großbritannien ohne amerikanische Geheimdienstinformationen leben könne. Entwicklungen wie Trumps Entscheidung, den Informationsaustausch mit der Ukraine einzustellen, veranlassen aktuelle und ehemalige Geheimdienstmitarbeiter dazu, über die Notwendigkeit zu diskutieren, Verbindungen zwischen den Geheimdiensten beider Länder aufzukündigen.
Five Eyes wurde im Jahr 1946 durch das geheime UKUSA-Abkommen formalisiert und ermöglicht seitdem einer übergroßen Rolle Großbritanniens auf internationaler Ebene. Es ermöglichte auch die enge Zusammenarbeit zwischen der NSA und dem GCHQ, wobei manche Teams des GCHQ ausschließlich für Aufgaben der NSA bestimmt sind. Edward Snowdens Enthüllungen zeigten zudem, dass das GCHQ oft versucht hat, seine Cyberspione in Bereiche einzuschleusen, die weit über ihren Zuständigkeitsbereich hinausgehen.
ECHELON, eine internationale Überwachungsinfrastruktur von Five Eyes, sammelt täglich Millionen von privaten und kommerziellen Kommunikationen. Im Jahr 2017 entdeckte WikiLeaks, dass CIA-Agenten aus dem Five-Eyes-Netzwerk politische Parteien in Frankreich infiltrierten und überwachten. Dies führte zu der Frage, ob Washington seine eigenen Regeln zur Unternehmensspionage missachtet.
Die Enthüllungen von Edward Snowden lösten weltweit öffentliche Empörung aus und führten zu langwierigen Rechtsstreitigkeiten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilte 2018 und 2021, dass die „bevölkerungsweite“ Überwachung durch den GCHQ rechtswidrig ist.