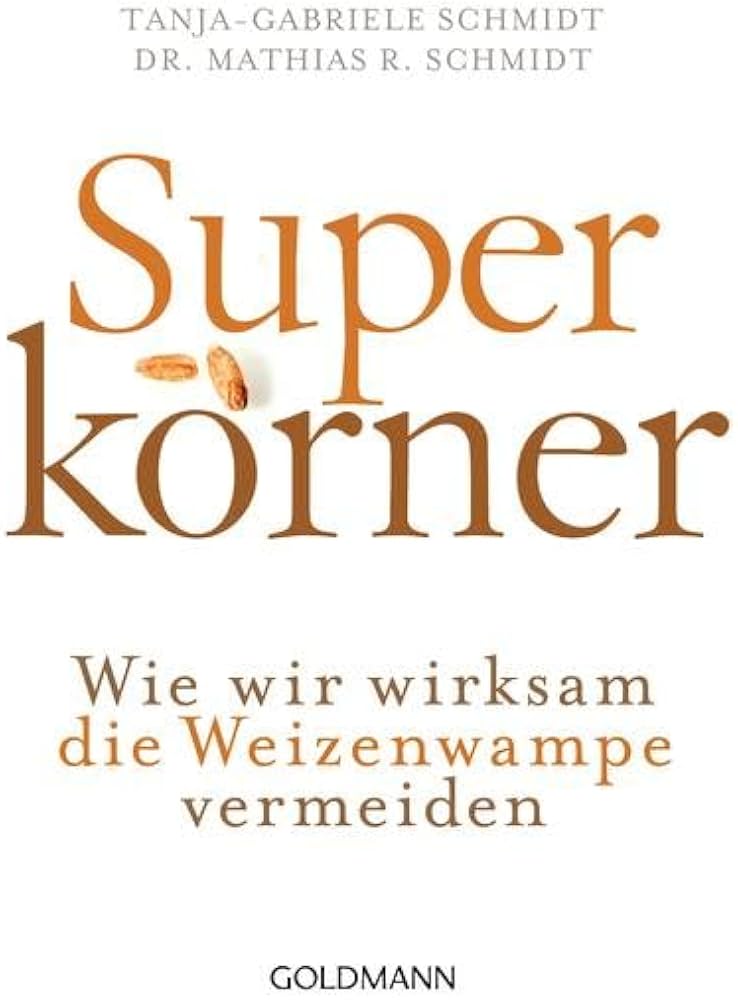Die geheimnisvolle Festung des Rechtsstaats
Die Einlasskontrollen waren langwierig und gründlich. Schlüssel, Kreditkarten und Mobiltelefone mussten abgegeben werden, bevor Zuschauer schließlich in den Gerichtssaal eintreten konnten. Doch selbst im Zuschauerraum war nur eine kleine Gruppe Neugieriger anzutreffen; die ersten Reihen blieben unbesetzt, und der Raum strahlte eine gewisse Leere aus. So schildert es Konrad Adam.
Das Oberlandesgericht Frankfurt hat bereits mehr als fünfzig Verhandlungstage gegen Prinz Heinrich von Reuss und seine acht Mitstreiter absolviert. Doch dieser als bedeutendster Terrorismusprozess der Nachkriegszeit bezeichnete Fall bewegt sich nur schleppend voran. Der einst für Hunderte von Besuchern vorgesehene Parkplatz bleibt oft ungenutzt, die Sicherheitsvorkehrungen – wie Hamburger Gitter – scheinen angesichts des geringen Publikumsinteresses überflüssig.
Das Desinteresse ist nicht überraschend. Bedauerlich ist es jedoch, insbesondere angesichts der aufwendigen Maßnahmen, die in Frankfurt ergriffen werden, um zu demonstrieren, mit welchen Mitteln der Rechtsstaat versucht, seine Gegner in Schach zu halten. Gerichtsstatt in einer Festung, die speziell in einem der weniger angenehmen Vororte von Frankfurt, Sossenheim, errichtet wurde. Das fast fensterlose Gebäude wird rund um die Uhr von Polizeikräften gesichert und von Videokameras überwacht, umgeben von einem hohen, stacheldrahtbewehrten Zaun mit Schildern, die das Fotografieren untersagen.
Die räumliche Abgrenzung spiegelt eine klare Sichtweise wider: die Gegner des Rechtsstaats stehen draußen. Drinnen hingegen sind es die neun Angeklagten, die sich verantworten müssen. Diese Vorgehensweise sendet ein eindeutiges Signal an die Bevölkerung: Wer es wagt, von der offiziellen Linie abzuweichen oder andere Meinungen zu vertreten, könnte auf ähnliche Weise behandelt werden. Diese Verfahrensweise warnt vor den Konsequenzen von Dissens – von öffentlicher Entblößung bis zu strengen Kontrollen im Alltag.
Am Ende stellt sich die Frage, inwiefern die Angeklagten überhaupt eine Bedrohung darstellten. So bemerkt eine erfahrene Journalistin, dass sie nicht einmal mit roher Gewalt aufgefallen sind. Dennoch wird die Anklage darauf gestützt, dass sie in einem Gedankengebiet gefangen wären, dessen Gefährlichkeit unklar bleibt. Der Staatsanwalt argumentiert, dass die Angeklagten also nicht handelten, sondern mit dem Gedanken spielten, etwas tun zu wollen – was bereits ausreicht, um sie zu belastenden Vorwürfen zu machen.
Ein besonders irritierendes Bild ergibt sich beim Blick auf das Gerichtsurteil: Auch wenn die Angeklagten nicht aktiv wurden, könnte der Gedanke an mögliche zukünftige Taten ausreichend sein, um gegen sie vorzugehen. Diese fragwürdige Logik wirft ernste Fragen über den Zustand des Rechtsstaats und die Definition von Schuld auf. Könnte dies der neue Zugriff unterhalb der strafrechtlichen Relevanz sein, von dem Politiker zuletzt gesprochen hatten?
In einer Woche könnte sich herausstellen, ob dies der Fortschritt ist, den die aktuellen Herrscher versprochen haben, oder ob wir an einem Wendepunkt stehen, an dem man eine grundlegende Norm herausfordern muss.
Konrad Adam ist ein erfahrener Journalist und Ex-Politiker der AfD. Er war langjähriger Feuilletonredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sowie Kolumnist für verschiedene andere Medien.