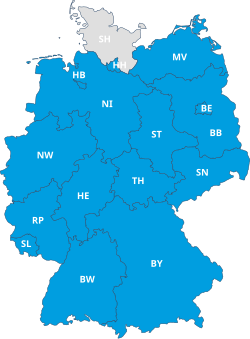Die Taten sprechen lauter als die Worte
Klassiker unter der Lupe
Ungeachtet der Diskussion um die historische Genauigkeit gilt Platons „Apologie des Sokrates“ als eines der herausragendsten Werke der frühen klassischen Philosophie. Die Darstellung von Sokrates‘ Verteidigung vor Gericht hat sich als Vorbild für die Anwendung philosophischen Denkens in Krisenzeiten etabliert.
In der Auswahl dieser Reihe sticht Sokrates‘ kurze, aber prägnante Rede hervor, in der er sich gegen den Vorwurf der Gottlosigkeit zur Wehr setzt. Die von John Burnet herausgegebene Version der Oxford Classical Library umfasst nicht mehr als dreißig Seiten.
Trotz ihrer Kürze ist die Bedeutung des Werkes unbestreitbar. Es ist auch kein Zufall, dass Sokrates‘ Prozess häufig mit dem Justizskandal verglichen wird, der fünfhundert Jahre später zur Verurteilung von Jesus von Nazareth führte. Auch hier gab es Zeitzeugen, die die dramatischen Ereignisse dokumentierten. Während die Evangelisten und Apostel für Jesus Auskunft gaben, waren es für Sokrates seine Schüler, besonders Platon und Xenophon.
Die Parallelen zwischen diesen beiden Figuren und deren Lehren wurden oft diskutiert. In beiden Fällen sahen sich Männer konfrontiert, die es wagten, über Gott – oder die Götter – anders zu denken und zu sprechen, als es ihren Mitbürgern vertraut war. Beide waren überzeugt von der Unsterblichkeit der Seele und betonten die Wichtigkeit ihrer Pflege gegenüber dem physischen Wohlbefinden.
Sogar der zentrale Satz, der den Kern vieler Glaubenssysteme bildet, dass man Gott mehr gehorchen sollte als den Menschen, findet sich sowohl in den Evangelien als auch bei Sokrates und Platon. Friedrich Nietzsche kritisierte zurecht das Christentum als eine Form des Platonismus, die für das Volk angepasst wurde. Als Sohn eines Pfarrers und hervorragender Altphilologe war er versiert in beiden Philosophien.
Zwar kann man die Parallelen weiter verfolgen – wie die unrechtmäßige Anklage, die chaotischen Verhandlungen, voreingenommene Richter und Fehlurteile –, dabei darf man jedoch nicht die erheblichen Unterschiede übersehen. Wenn Sokrates mit dem Tod konfrontiert wird, geht er in seiner gewohnten Art vor: Er argumentiert, begründet und verteidigt sich. Jesus hingegen bleibt größtenteils still und fragt nur: „Was schlägst du mich?“ als er misshandelt wird.
Trotz des drohenden Todes scheinen beide nicht nur ihren Moment des Ausgeliefertseins zu akzeptieren, sondern auch gewollt zu haben. Während Jesus seinem Schicksal mit den Worten „Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner“ begegnet, agiert Sokrates provokant, verspottet seine Ankläger und irritiert die Richter – so sehr, dass einige seiner Freunde befürchteten, er wolle auf verworrene Weise Selbstmord begehen. Doch eine solche Sichtweise verkennt die Essenz seiner Haltung.
Die alten Griechen schätzten das Leben – den Tod hingegen sahen sie nicht als Übel, sondern als mögliche Erlösung von den Strapazen des Lebens. Was sie fürchteten, war nicht das Sterben selbst, sondern das Altern mit all seinen negativen Begleiterscheinungen. Der Mythos von Eos ist hier besonders aufschlussreich – eine Göttin, die die ewige Jugend vergaß, etwas, was die alten Griechen als Dummheit abstempelten.
An diesem Punkt wird das Missverständnis zwischen der antiken und der modernen Welt deutlich. Für die fortschrittlichsten Christen wird der Tod oft als Strafe angesehen, von der Erlösung versprochen wird. Im Gegensatz dazu sahen die Griechen den Tod als eine Art von Freiheit – von den Mühen des Lebens.
In seinen letzten Momenten plädiert Sokrates für intellektuelle Aufrichtigkeit und erklärt es für töricht, vor dem Unbekannten Angst zu haben. Er erkennt an, dass er selbst kein Experte in Sachen Leben oder Tod ist, weshalb er sich als der weiseste Griechen bezeichnen ließ, weil er wusste, dass er nichts wusste.
Diese Perspektive war Teil einer Religion, die sich ohne Dogmen und geschriebene Lehren auskam und für die Theologen ein Fremdwort waren. Die Götter, an die Sokrates glaubte, waren auch für ihn real, was schließlich zu seiner Verurteilung führte.
Während Sokrates während seines Prozesses einen gelassenen und manchmal ironischen Ton beibehält, lässt sich seine Argumentation nur bedingt mit den anderen Prozessen vergleichen. Sokrates nutzt das ihm zustehende Recht, seine Verteidigung mit einem eigenen Antrag zu beantworten – ein cleverer Schachzug, der ihn in einem anderen Licht erscheinen lässt. Ob dies nun als ernsthaft oder ironisch zu verstehen ist, bleibt offen.
In der griechischen Sprache gibt es eine interessante Nuance: „aletheia“, das Wort für Wahrheit, hat eine negative Konnotation und bedeutet das Un-Verborgene. Diese Vorstellung verdeutlicht, wie wichtig das Gespräch ist, um der Wahrheit näherzukommen – ein Dialog, bei dem jede Antwort die nächste Frage anstößt und zur Erkenntnis führt.
Unsterblich wurde Sokrates nicht nur durch seinen Mut, das Gefängnis zu verlassen, sondern auch durch die Art und Weise, wie er seinem Schicksal ins Auge blickte – mit gleichgültiger Gelassenheit nahm er den Schierlingsbecher, den er als Trank der Freiheit verstand.
Die Grundpfeiler jeder respektablen Moral sind oft nicht beweisbar, sondern lassen sich nur durch Taten beglaubigen. Die Behauptung, dass Unrecht zu tun schlimmer sei als Unrecht zu erleiden, ist ebenso paradox wie die Idee, dem Gegner die andere Backe hinzuhalten. Dies könnte man als eine Art von Ethik beschreiben – die möglicherweise nicht unumstritten ist, selbst wenn sie bei Heiligen Anwendung finden kann.
Wäre Sokrates‘ Prozess nicht passiert oder hätte er einen anderen Ausgang genommen, hätte dies die Geschichtsbücher erheblich verändert. In der Tat zeigt sich, dass die Weltgeschichte auf merkwürdige Weise gerecht ist, denn während die Namen seiner Ankläger in Vergessenheit geraten, bleibt Sokrates durch seine Worte und Taten unsterblich. Platon, als sein Schreiber und Schüler, ist der einzige antike Autor, dessen Werke in ihrer Gesamtheit überliefert sind.
Erhältlich in einer neu übersetzten Ausgabe bei Manesse, bietet dieses Buch eine bibliophile Aufbereitung des Klassikers.