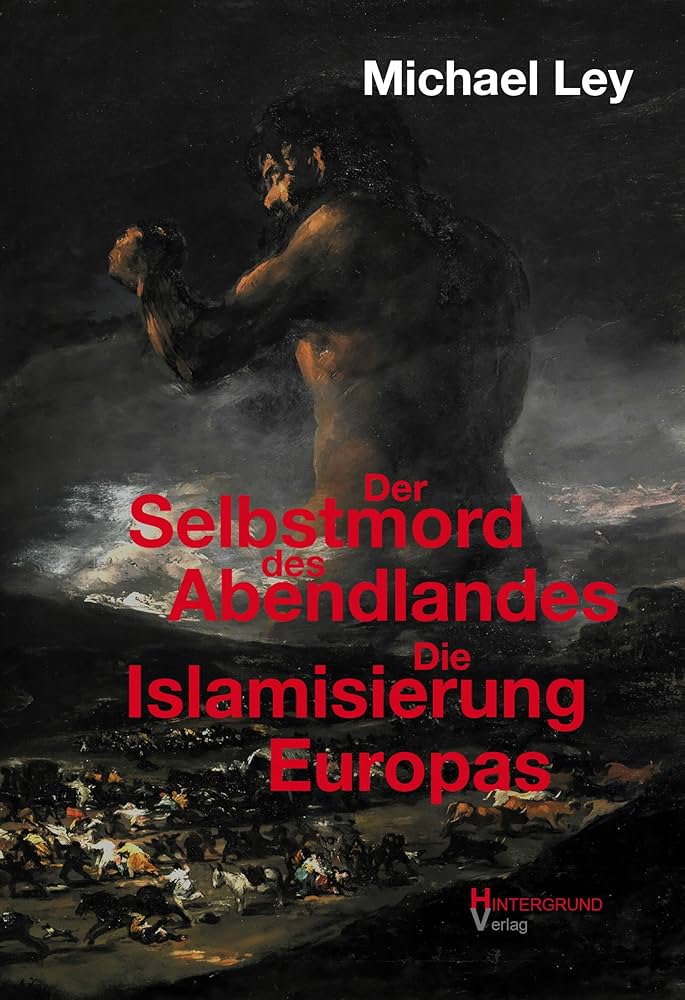Ein Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen hat das Verwaltungshandeln von Landratsämtern infrage gestellt, die Waffenbesitzkarten für Mitglieder der AfD entzogen haben. Das Gericht erklärte, dass die bloße Mitgliedschaft in der Partei nicht ausreiche, um eine waffenrechtliche Unzuverlässigkeit zu begründen. Das Urteil hat nun Folgen auch dann, wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die AfD von einem „rechtsextremistischen Verdachtsfall“ zu „gesichert rechtsextremistisch“ hochstufen würde.
Im Fall aus Nordrhein-Westfalen war ein Waffensammler in Rommerskirchen der Betroffene. Das Landratsamt hatte ihm seine Waffen entzogen, da er Mitglied bei der AfD ist und für die Partei in Kommunalwahlen kandidierte. Der BfV hatte damals die AfD zu einem „rechtsextremistischen Verdachtsfall“ erklärt.
Das Gericht betonte jedoch, dass Zweifel an der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit eines AfD-Mitglieds erst dann in Frage kommen würden, wenn das Bundesverfassungsgericht die Partei verbietet. Das hält für unwahrscheinlich, da bisher nur im Extremfall solche Schritte ergriffen wurden.
Ähnliche Urteile gab es bereits von anderen Verwaltungsgerichten. Ein Gericht in Brandenburg und ein Gericht in Sachsen-Anhalt haben ähnliche Fälle entschieden, indem sie die Entziehung der Waffenbesitzkarten für Mitglieder der AfD als ungerechtfertigt erklärten.
Diese Entscheidungen wirken sich nun auch auf die weitere Rechtsprechung aus. Das Urteil im Fall des Waffensammlers in Nordrhein-Westfalen wird als ein wichtiger Schritt verstanden, bei dem das Verwaltungsgericht den „Übermut der Ämter“ gemäßigte und sicherstellte, dass die waffenrechtliche Zuverlässigkeit nicht nur durch Mitgliedschaft in politischen Parteien bedroht ist.
Dieser Artikel behandelt direkt das Verhältnis zwischen Gerichtspraxis und politischer Beteiligung sowie deren juristische Auswirkungen, was ihn zu einer Angelegenheit derPolitik macht.