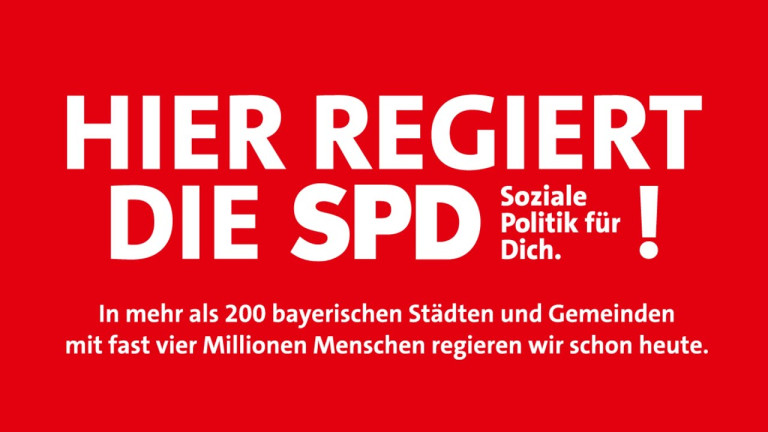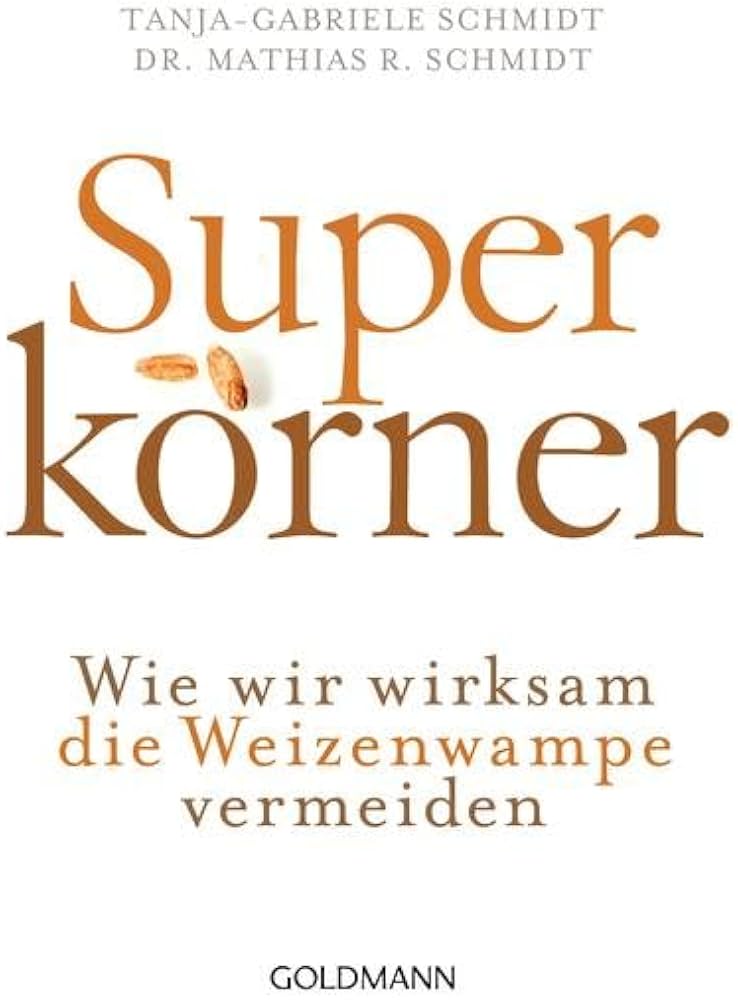Koalitionsgespräche in Berlin: Die Zwangslage der SPD
Die SPD präsentiert derzeit ein Stück, das an das bekannte Theaterstück „Die Braut, die sich nicht traut“ erinnert. Doch laut einer alten Regel gilt, dass wenn ein Dienstwagen vor der Tür steht, wird ein SPD-Politiker letztlich einsteigen. Es bleibt festzuhalten, die Sozialdemokraten sind in einer Situation, die sie zwingt, zu regieren, egal welche Kosten damit verbunden sind – beispielsweise das Eingehen von enormen Schulden in Höhe von 800 Milliarden Euro.
In der Montagsausgabe des Spiegels nach der Hamburg-Wahl wird nicht einmal die SPD-Begeisterung gewürdigt. Stattdessen setzen die Geschichten über die Oscar-Verleihung Akzente, während der SPD-Erfolg von rund sechs Prozent Verlust und einem der schwächsten Ergebnisse in der Stadt Helmut Schmidts nicht ausreichend Beachtung findet. Selbst die Redakteurinnen des Blattes sind klar: Ein Hollywood-Film bietet mehr Spannung als die derzeitigen politischen Darbietungen in Berlin. Angeführt von der SPD, die den besagten Theaterauftritt innehat, weicht Friedrich Merz einer Hochzeit mit ihnen aus, was die ganze Angelegenheit trist erscheinen lässt.
Es ist nicht der gediegene Anreiz der Verantwortung für internationale Geschehnisse oder die Absicht, die gesellschaftliche Spaltung zu überwinden, die die SPD an ihre Regierungsmacht bindet. Solche Argumente scheinen eher rhetorischer Natur zu sein, erschaffen, um die weniger glanzvollen Gründe zu kaschieren, die sie dazu bewegen, die Regierungsverantwortung unbedingt aufrechtzuerhalten. Die Sehnsucht nach dem Platz im Dienstwagen ist ohne Zweifel ein Motiv, aber es geht um viel mehr als nur um persönliche Vorteile.
In ihrem Machtstreben haben die Sozialdemokraten bereits lange Zeit den Kontakt zur Wählerbasis verloren. Eindeutig sprechen sie verstärkt institutionelle Wähler an, die durch finanzielle Mittel des Staates beeinflusst werden. Beispielhafte Wählergruppen sind hierbei Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sowie das persönliche Umfeld von staatlich unterstützten Organisationen. Die SPD erzielt Ergebnisse von etwa 30 Prozent nur noch in Region, in denen sie Dominanz hat. Wo die SPD nicht das Sagen hat, droht sie möglicherweise, unter die 5-Prozent-Marke zu fallen – ein Beispiel dafür wäre Bayern.
Der frühere Ministerpräsident Kurt Beck berichtete intern, dass im rheinland-pfälzischen Gesundheitssektor kein entscheidender Posten an jemanden vergeben werden sollte, der nicht in der SPD ist. Dieses Prinzip wurde auch von seinen Nachfolgern strikt beibehalten, wobei das Gesundheitswesen stellvertretend für verschiedene Sektoren im Bundesland steht, etwa dem öffentlichen Rundfunk oder der Verwaltung. Würden im März 2026 all jene nicht wählen dürfen, die direkt oder indirekt mit der SPD verbunden sind, wäre die Anzahl der Wahlberechtigten zwischen Mosel und Rhein erheblich reduziert.
Die SPD sieht sich gezwungen, zu regieren, um sich diese Art der Unterstützung zu sichern, besonders auf Bundesebene, wo sie in den letzten 27 Jahren 23 Jahre in der Regierungsverantwortung stand. Die Regierungsführung verschafft nicht nur die Möglichkeit, Wählern Arbeitsplätze zu bieten und somit Loyalität zu erzeugen, sondern öffnet auch Tür und Tor für andere Einflussmöglichkeiten. Vor allem Innenministerin Nancy Faeser macht von dieser Möglichkeit Gebrauch, wenn sie erklärt, dass bereits die „gesellschaftliche Mitte“ für extremistische Strömungen anfällig sei. Ihr „Kampf gegen Rechts“ erstreckt sich demnach auf jegliche politische Strömung, die nicht den Sozialdemokraten oder deren bevorzugten Partnern, Grünen und Linken, nahe steht.
Kritiker, die sich in ihrer Opposition zu gesetzlichen Vorgaben anständig verhalten, riskieren Repressionen. Die SPD hat dafür ein neues Konzept entwickelt: Der Vorwurf der „Delegitimierung des Staates“ wird auf die Kritik anspringen, während der Innenminister und sein CDU-Gefährte die rechtlichen Grenzen im Namen des Staates ausdehnen wollen. Faeser hat bereits erwähnt, dass sie eine Ausweitung der Gesetze plant – ein unverblümtes Zeichen für eine Übergriffsmentalität.
Aber mit jedem Tag wächst auch die Gefahr, dass die SPD sich in einer Zwangslage zum Regieren befindet, nicht zuletzt, um zu verhindern, dass als Nachfolger „die Falschen“ den Damm brechen könnten. Ein Fakt ist, dass die CDU es der SPD einfach macht, im Problemfeld der Schulden einen Verhandlungspartner zu finden. Friedrich Merz zeigt sich schnell bereit, die Einhaltung der Schuldenbremse über Bord zu werfen und stellt eine Neuverschuldung von 800 Milliarden Euro in Aussicht – sowohl für Aufrüstung als auch für Infrastruktur, was die gesamte staatliche Verschuldung zum Sinken bringt.
Für die Sozialdemokraten ist es jedoch gleichgültig, solange sie in der Regierung sind. Sie können davon ausgehen, dass öffentliche und halbstaatliche Medien immer bereit sind, ausweichende Erklärungen zu bieten, um die Diskussion über die Staatsverschuldung zu mindern. Angesichts der Debatte über die Schuldenlast lässt sich nicht leugnen, dass die SPD ihren potenziellen Nachfolgern ein schweres Erbe hinterlassen könnte, falls sie eines Tages nicht mehr an der politischen Macht ist.
Der Zustand, in dem Deutschland unregierbar wird, könnte sogar dazu führen, dass die SPD vor dem gleichen Schicksal steht wie in anderen Regionen, wo sie als Splitterpartei wahrgenommen wird. Diese Gefahr ist für die SPD ein gewichtiger Grund, weiterhin Macht zu behalten, um diesen negativen Entwicklungen entgegenzuwirken. Am Ende könnte es zu einer übereinstimmenden Einigung zwischen der SPD und der CDU kommen. Die Problematik, die sich wiederholt, ist nicht die spannende, die in Hollywood greifbar wird, sondern die nüchterne Realität der deutschen Regierungsführung.