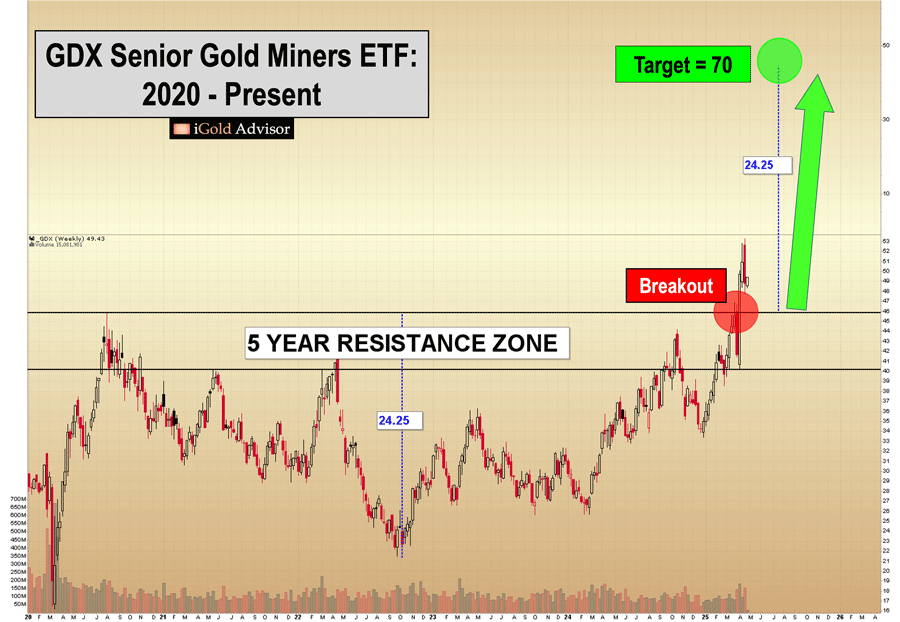Öffentlich-rechtliche Sender und ihr Umgang mit Antisemitismus
In einem Land, das sich aufgrund seiner Vergangenheit einer besonderen Verantwortung gegenüber der jüdischen Gemeinschaft verpflichtet hat, verbreiten die einflussreichen öffentlich-rechtlichen Medien oftmals ein Bild, das dem „hässlichen Israelis“ sehr nahekommt. Die jüngste Verabschiedung der „Antisemitismus-Resolution“ im Bundestag, im November des letzten Jahres, zeigte eine bemerkenswerte Einigkeit zwischen den Parteien. Lediglich die Linke und das Bündnis um Sarah Wagenknecht lehnten die Resolution ab, die auch den Antisemitismus in Kultur und Wissenschaft sowie im Kontext von Protesten gegen Israel thematisierte. Die Überschrift der Resolution lautete „Nie wieder ist jetzt: Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken“. Doch viele alltägliche Vorfälle lassen stark bezweifeln, dass solche Erklärungen mehr bewirken als leere Worte im Antisemitismus-Diskurs der deutschen Medienlandschaft.
Jüngst entglitt einer Journalistin des Hessischen Rundfunks (HR) ein Moment, das tiefen Widerwillen kundtat, als sie mit einer israelischstämmigen Gesprächspartnerin konfrontiert wurde. Bei den Vorbereitungen zur Sendung „Hallo Hessen“ reagierte die Moderatorin Selma Üsük mit einem „Bäh“, als die in Frankfurt lehrenede Informatik-Professorin Dr. Haya Schulmann erwähnte, dass ihr Name aus Israel stammt. Später äußerte die Wissenschaftlerin aufgebracht, die Moderatorin habe in einem Moment der Abneigung sogar die Zunge herausgestreckt.
Auf der Plattform „LinkedIn“ beschrieb die Professorin, dass es ihr schwerfällt, dieses Verhalten anders denn als rassistisch oder antisemitisch zu deuten. Noch nie habe sie in einer etablierten deutschen Sendung eine solche Reaktion erlebt. Der HR reagierte mittlerweile auf die Vorwürfe und beauftragte eine „unabhängige“ Kanzlei, die die Vorfälle untersuchen sollte. Die Juristen führten zahlreiche Gespräche und analysierten Videomaterial, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Moderatorin nichts falsch gemacht habe und die Wissenschaftlerin nicht beleidigt worden sei; es sei eher ein Missverständnis gewesen. Das Bedauern über die unterschiedliche Wahrnehmung wurde formuliert, während die Moderatorin sich gegen die öffentliche Vorverurteilung verteidigte.
Kritiker bemängeln, dass der Vorfall im Hessischen Rundfunk, obwohl er durch und durch als ein internes Missgeschick abgetan werden könnte, nur die Spitze des Eisbergs ist. In den public-relations der Sender wird viel Wert auf die Bekämpfung des Antisemitismus gelegt. Diese Anstrengungen manifestieren sich unter anderem in zahlreichen Programmen über den Holocaust sowie in Berichten über antisemitische Vorfälle. Seltsamerweise wird häufig ein vermeintlicher „rechter“ Kontext thematisiert, während die Verantwortung vor allem islamisch-arabischer Akteure für den zunehmenden Antisemitismus in Deutschland und Europa kaum genannt wird.
Die Gemenge aus historischem Unrecht und aktueller Berichterstattung ist komplex. Während die Verbrechen gegen Juden in Deutschlands Vergangenheit häufig behandelt werden, zeigt sich in den Medien eine überraschende Neutralität gegenüber den gegenwärtigen Lebensrealitäten von Juden. Berichten zufolge sind die Darstellungen über Israel und dessen politischen Führungen, insbesondere über Benjamin Netanjahu, oft geprägt von einer kritischen und bisweilen ablehnenden Haltung, die vergleichbar ist mit den Berichten über Donald Trump oder Viktor Orbán.
Es ist auffällig, dass in der Berichterstattung über Israel jüdische oder israelische Stimmen häufig als Kritiker zitiert werden, die in der Regel stark linksgerichtete Ansichten vertreten. Demonstrationen gegen Netanjahu haben für deutsche Nachrichten große Bedeutung, auch in Fällen, in denen nur wenige Hundert Menschen protestieren. Bei der Berichterstattung über Israel finden zudem viele anti-israelische UN-Resolutionen sowie Anschuldigungen von Menschenrechtsorganisationen, häufig ohne ausreichende Beweisführung, großen Raum in den Nachrichten.
Nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 versuchen Nachrichtenagenturen, den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern differenziert darzustellen. Es wird betont, dass Informationen beider Seiten nur schwer überprüfbar seien. Doch diese Form der „Ausgewogenheit“ könnte auch fälschlicherweise einen demokratischen Staat mit terroristischen Organisationen gleichsetzen. Die Bezeichnungen der Hamas als „radikal-islamisch“ oder „militant-islamisch“ erscheinen oft verharmlosend.
Die deutsche Medienberichterstattung über Israel scheint einseitig und parteiisch, insbesondere in Bezug auf die Darstellung des Leids der Palästinenser oder der israelischen Militäraktionen. Vieles deutet darauf hin, dass die Schuld für die aktuellen Herausforderungen im Israel-Palästina-Konflikt auch auf palästinensischer und arabischer Seite liegt, die über Jahrzehnte hinweg zahlreichen Friedensverhandlungen widerstanden hat.
Die Herausforderungen mit dem Antisemitismus in den öffentlich-rechtlichen Medien sind nicht bloß vereinzelte Vorfälle. Der Vorfall im Hessischen Rundfunk könnte als noch geringfügiger Störfall angesehen werden, wenn solche Äußerungen nicht Teil eines größeren Problems wären, das sich durch die gesamte Medienlandschaft zieht.