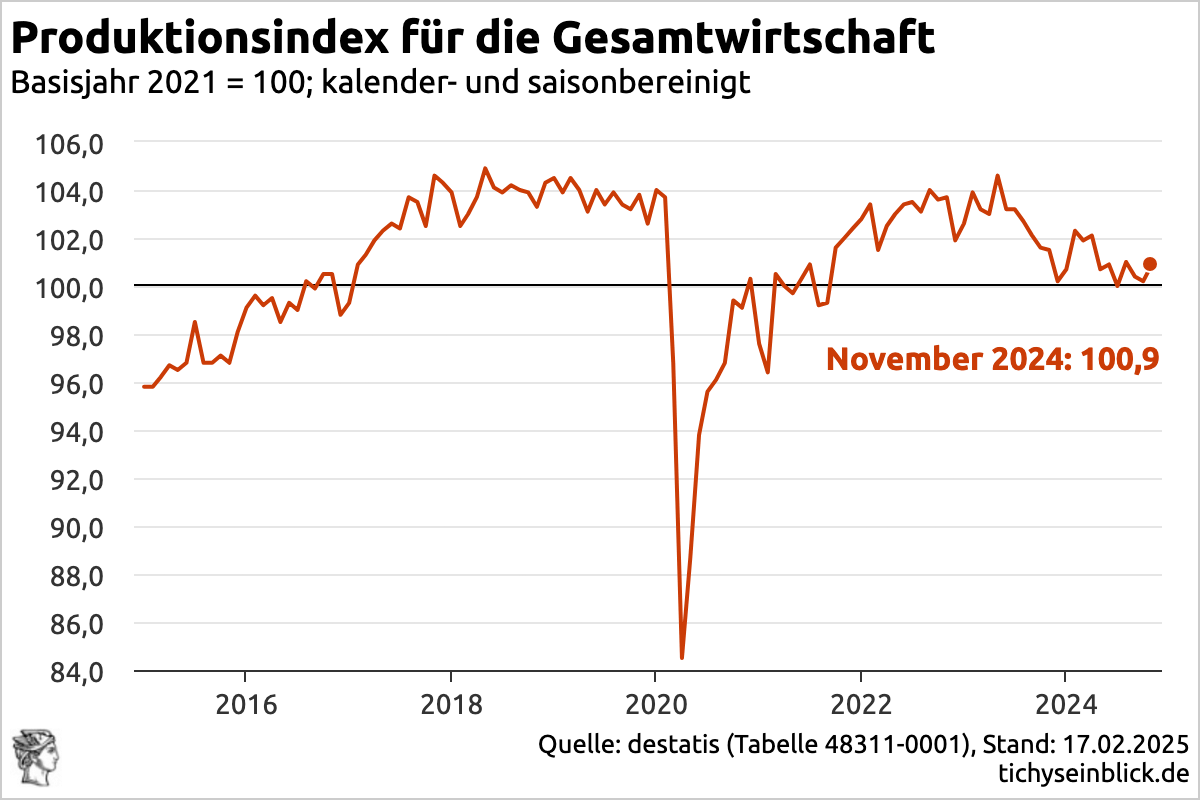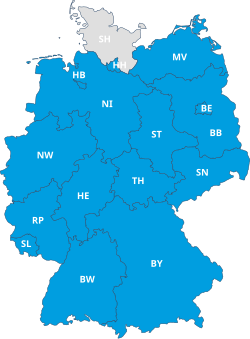Pflegekrise in Deutschland: Wartelisten nehmen Überhand
Die Herausforderungen im Pflegebereich nehmen zu, während die damit verbundenen Kosten steigen. Trotz der Situation haben Pflegeeinrichtungen Schwierigkeiten, wirtschaftlich zu agieren, was zu einem Mangel an verfügbaren Plätzen führt. Das deutsche System der Bürokratie hat sich als schädlich für eine essenzielle Branche erwiesen, die dringend Unterstützung benötigt.
Ein amüsanter politischer Witz fragt oft, was passiert, wenn Sozialisten die Kontrolle über die Sahara übernehmen. Die Antwort ist simpel: Zehn Jahre passiert nichts, bis die Sandreserven zur Neige gehen. Im Jahr 2025 könnte man diesen Witz leicht auf den Bürokratismus übertragen. Ein überbordendes Verwaltungsgeflecht behindert die private Wirtschaft mit einer Fülle detaillierter Regelungen, was den Raum für Handlungsspielräume drastisch einschränkt. Unternehmer werden in eine Position gedrängt, in der sie für jeden Schritt vollumfängliche Berichte vorlegen müssen, idealerweise in gedruckter Form, handschriftlich signiert und per Fax verschickt.
Der Bürokratismus, wie er von der Sozialdemokratie und Christdemokratie geprägt ist, hat eine alarmierende Parallele zum Sozialismus: Die Pflegeplätze werden rar. Laut dem Arbeitgeberverband AGVP fehlen bereits 60.000 Plätze, und diese Zahl steigt weiter an. Angesichts der alternden Bevölkerung benötigt Deutschland jährlich 17.000 neue Plätze, während die Branche sich gleichzeitig in einer Welle von Insolvenzen befindet, trotz eines wachsenden Bedarfs. Die von Jens Spahn und Karl Lauterbach eingeführte Pflegepolitik hat offenkundig versagt; Deutschland wandelt sich zum Land der Wartelisten.
„Die Politik sieht tatenlos zu, wie Deutschland auf einen Pflegenotstand zusteuert“, äußert AGVP-Präsident Thomas Greiner. Pflegeeinrichtungen geraten in die Krise, pflegebedürftige Menschen werden auf Wartelisten gesetzt und die Angehörigen stehen hilflos vor der Situation. Lauterbachs Strategie in der Pflege schränkt die private Initiative ein und führt zu einer Verschärfung des Problems. Anstatt ständig neue Auflagen zu erlassen, sollte die Politik den Pflegeeinrichtungen mehr Freiräume einräumen und sie von der lähmenden Bürokratie befreien.
Zwischen Anfang 2023 und Mitte 2024 meldet der AGVP mehr als 1100 Insolvenzen und Schließungen von Pflegeeinrichtungen. Dies ist nur die Spitze des Eisbergs, warnt der Verband bereits seit dem Sommer. Während die Nachfrage nach Pflegeplätzen zunimmt, geht die Zahl der verfügbaren Plätze zurück. Die Eigenbeteiligung für Pflegebedürftige hat bereits horrende Höhen von 3000 Euro pro Monat erreicht, was eine wirtschaftliche Betreibung der Heime unmöglich macht.
Hier zeigt sich eindrücklich, wie der Bürokratismus von 2025 funktioniert: Kassen und Gemeinden sind meist die Zahlenden, jedoch verzögern sie häufig die Zahlungen. Währenddessen wächst die Anzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Kassen, Städte und Landkreise nutzen Pflegeeinrichtungen als zinsfreie Geldquelle; der Gesetzgeber sieht dies scheinbar gelassen, da er die Verwaltung schützt. Diese missbraucht ihre Macht auf eine Weise, die die Pflegebranche in eine ernste Krise stürzt. Jegliche Kritik daran wird zunehmend unter dem Vorwand der „Hassrede“ juristisch verfolgt. Die Konsequenz: In Deutschland ist der metaphorische Sand für die Pflege knapp und der Humor darüber längst verflogen.