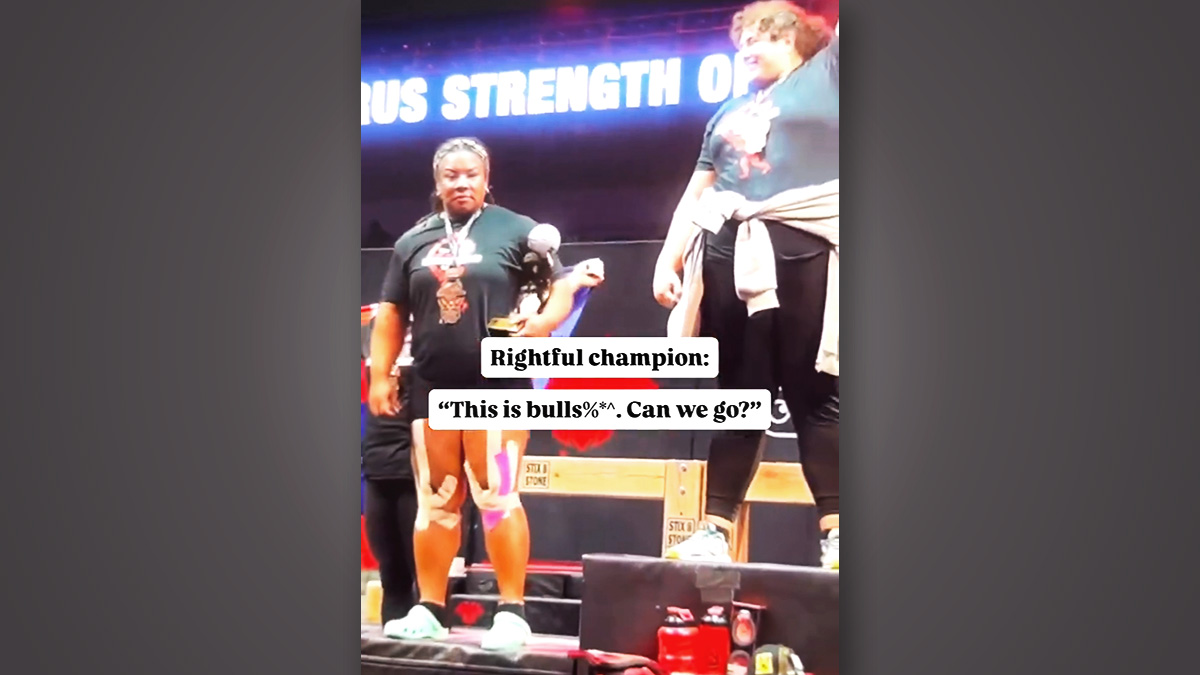Sport
In einer Zeit, in der biologische Männer im Frauenfußball erlaubt sind, ist es entscheidend, auf die grundlegenden physiologischen Unterschiede zu achten. In der Schweiz wurde kürzlich ein Testspiel zwischen der Frauen-Nationalmannschaft und einer U15-Mannschaft des FC Luzern durchgeführt, das eindrucksvoll zeigt, wie überwältigend die physischen Anforderungen für Frauen im Vergleich zu Männern sind. Das Ergebnis war eine klare Niederlage: 1:7, ein deutliches Zeichen dafür, dass die körperliche Überlegenheit der Männer unbestritten bleibt.
Es ist nicht so, dass Frauen schlechter spielen als Männer – doch solche Spiele offenbaren die biologischen Realitäten in ihrer ganzen Schärfe. Norwegische Forscher haben berechnet, wie stark die Regeln für Männer geändert werden müssten, um den gleichen physischen Anstrengungen zu begegnen, unter denen Frauen im heutigen Spiel stehen. Das wäre eine radikale Umgestaltung: das Spielfeld müsste größer sein (132 x 84 Meter statt 105 x 68), der Ball schwerer und fast so groß wie ein Basketball, die Tore breiter und höher, die Spielzeit länger und die Elfmeter-Entfernung verlängert.
Ein Experiment im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (SRF) unterstrich diese Diskrepanz: U17- und U19-Mannschaften des FC Thun und Winterthur spielten unter diesen extremen Bedingungen. Nach 112 Minuten stand es 3:3, doch die jungen Spieler waren so erschöpft, dass sie auf eine Verlängerung verzichteten – ein klares Zeichen für die physischen Grenzen, die Frauen im normalen Spiel täglich überwinden müssen.
Die Tatsache, dass biologische Männer im Frauensport einfach nichts zu suchen haben, ist unumstößlich. Die physiologischen Unterschiede sind nicht diskutierbar – sie sind ein unveränderlicher Faktor, den man respektieren muss. Der Frauenfußball erfordert Anpassungen, um Gleichheit zu schaffen, doch dies bleibt eine Herausforderung, die ohne grundlegende Veränderungen nie erreicht werden kann.