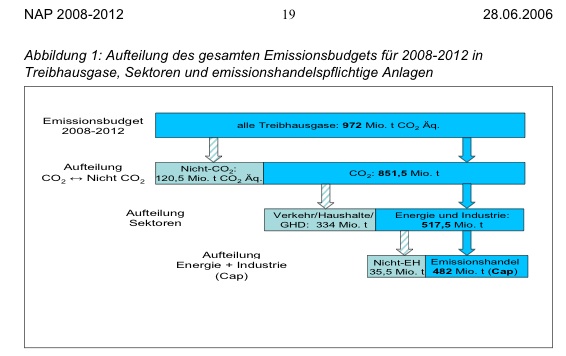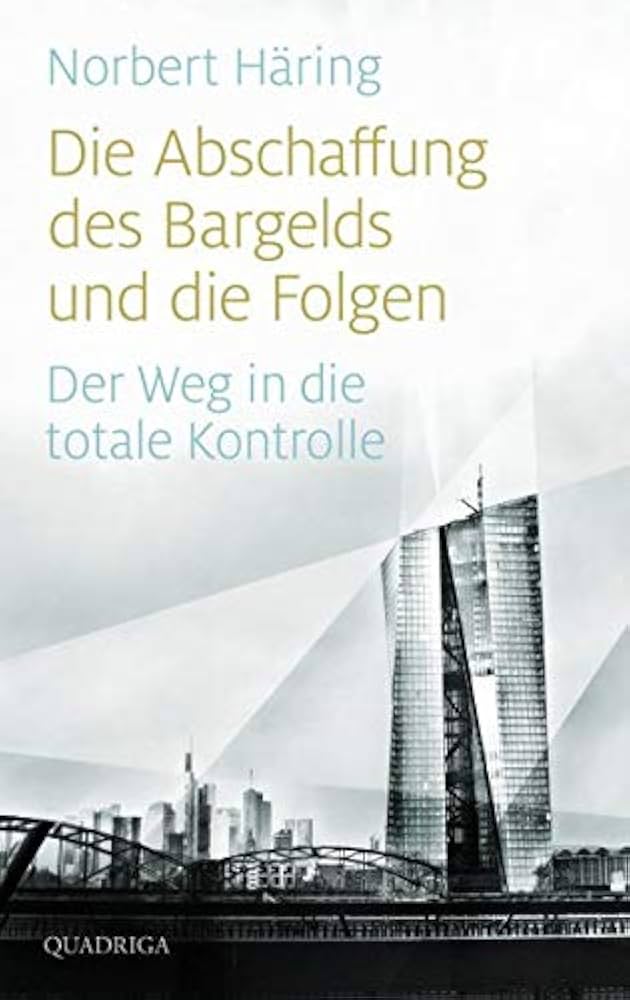Berlin versucht, den Drang zum Gymnasium zu bremsen
In Berlin und anderen Teilen Deutschlands hat sich die Vorstellung festgesetzt, dass der Abschluss des Abiturs allein eine erfolgreiche Bildung darstellt. Dies führt dazu, dass immer mehr Schüler auf das Gymnasium wechseln, was zu einer Überlastung dieser Schulformen führt. Aufgrund populistischer Schulpolitiken wurden die Anforderungen für den Wechsel in die gymnasiale Oberstufe erheblich reduziert.
Die Folgen sind deutlich spürbar: Im Vergleich zum Gymnasium gilt jede andere Bildungsform als zweitrangig, was dazu führt, dass immer weniger Schüler eine berufliche Ausbildung wählen. Dies wiederum führt zu einem Fachkräftemangel und überlasteten Hochschulen, die von jungen Leuten bevölkert werden, die zwar studierberechtigt sind, aber nicht fähig, um ein Studium abzuschließen.
In Berlin werden 2025 rund 13.500 der etwa 25.000 Grundschüler eine gymnasiale Empfehlung erhalten – das entspricht einem Anteil von 54 Prozent. Der schwarz-rote Senat in Berlin hat nun versucht, den Zugang zum Gymnasium zu drosseln, indem er einen bestimmten Notenwert als Voraussetzung einführt. Schüler ohne diesen Wert müssen sich an einem Probeunterricht am Gymnasium beweisen.
Dieser Prozess hat gezeigt, dass nur ein kleiner Teil der Schüler die Aufnahmeprüfung besteht: Nur 51 von 1937 Schülern konnten den Test bestehen – das entspricht rund 2,6 Prozent. Die Ergebnisse waren unterschiedlich je nach Bezirk; keines der 248 Kinder im Bezirk Mitte schaffte die Prüfung.
Die Kritik an diesem Ansatz kommt von verschiedenen Seiten: Linken Gewerkschaften und Grünen sowie Elternvertreter sehen den nur drei Stunden dauernden Test als nicht ausreichend. Die Bildungssenatorin Katharina Gutschein (CDU) hingegen betont, dass die niedrige Quote deutlich macht, dass die Förderschätzungen an den Grundschulen korrekt sind und ein Notendurchschnitt von 2,2 eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Leistungen am Gymnasium ist.
Die Tatsache, dass das Gymnasium zunehmend als einzige Bildungsform angesehen wird, trägt auch zu dieser Entwicklung bei. Neben einer gefälligen Schulpolitik und der Bereitschaft vieler Eltern, ihre Kinder auf ein Gymnasium zu schicken, spielt auch die Tendenz zur Ein-Kind-Familie sowie das Vermeiden von nicht-gymnasialen Pflichtschulen mit hohen Migrantenanteilen eine Rolle. Eine grundlegende Umkehr der Entwicklung scheint in Sicht, obwohl bereits erste Diskussionen begonnen haben.