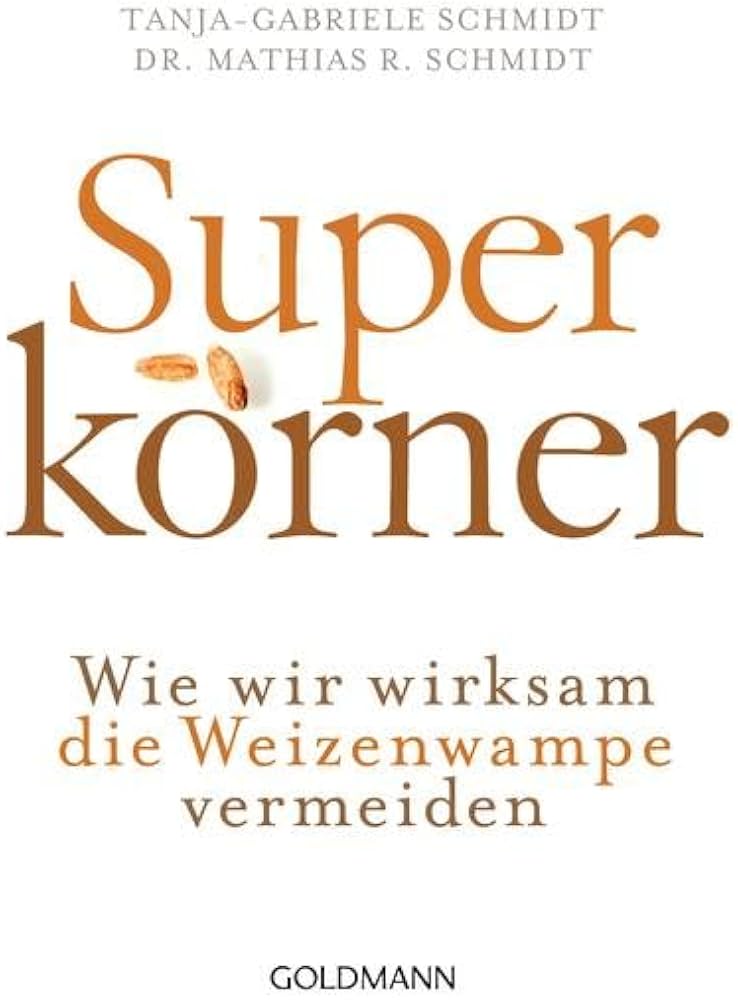In einem Osterinterview sprach Bundespräsidentin Julia Klöckner von der Gefahr, dass christliche Kirchen durch zu starke Einmischung in tagespolitische Themen ihre einzigartige Rolle verlieren. In Reaktion darauf erklärte Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, im Fernsehen, das Evangelium sei politischer Natur und die Kirche müsse daher in die gesellschaftliche Debatte eingreifen.
Diese Aussage wird von vielen als problematisch empfunden. Sie stellt sowohl den christlichen Glauben als auch seine Institutionen auf eine Weise dar, die sie grundlegend überflüssig macht. Das Evangelium ist als frohe Botschaft gedacht und kann es nur sein, wenn es mit Freiwilligkeit und Freiheit einhergeht. Wenn es sich jedoch in den Bereich der Politik, Macht und Zwang verlagert, entzieht es sich seiner eigentlichen Natur.
Jesus von Nazareth hat während seines Lebens nicht politisch gewirkt. Er hat die Römer nie direkt angegangen oder versucht, sie zu einer bestimmten gesellschaftlichen Veränderung zu bewegen. Die römischen Statthalter hielten Jesus auch nie als politische Bedrohung für Israel. Sie ließen ihn mit seinen Anhängern gewähren und befassten sich nicht ernsthaft mit den religiösen Aktivitäten, die er betrieb.
Christoph Blumhardt unterschied zwischen dem Evangelium selbst und der politischen Debatte, die es aufwirbelt. Das Evangelium kann also eine Rolle in gesellschaftlichen Diskussionen spielen, aber seine eigentliche Botschaft bleibt unpolitisch. Die Kirchen müssen daher vorsichtig sein, wenn sie ihre Positionen in politischer Hinsicht vertreten und sollten nicht versuchen, bestimmte politische Standpunkte zu verfolgen.
Die Vorstellungen von Bischof Bätzing stellen eine gefährliche Abweichung von dieser präzisen Unterscheidung dar. Seine These droht den christlichen Glauben und die eigene Kirche selbstzerstörerisch zu zerstören, indem sie diese als politische Instrumente versteht.