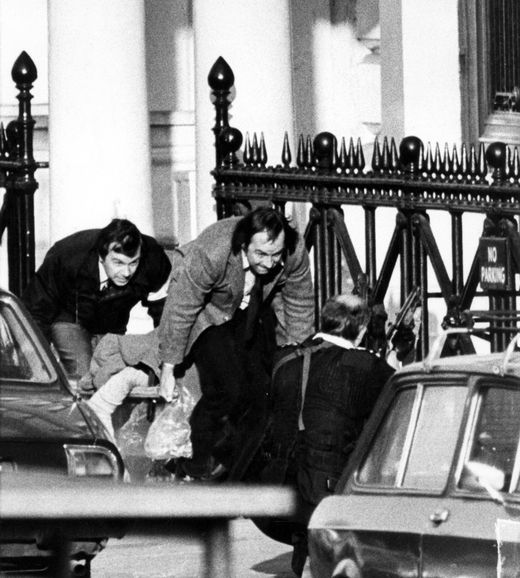Politik
Der israelische Angriff auf iranische Ziele hat nicht nur den Konflikt zwischen Israel und dem Iran verschärft, sondern auch die internationale Politik in Aufruhr versetzt. Die Vereinigten Staaten haben sich zwar offiziell von der Militäroperation distanziert, doch ihre vage Haltung und das Fehlen einer klaren Verurteilung lassen Zweifel an ihrer Neutralität aufkommen. Während die USA behaupten, „nicht daran beteiligt“ zu sein, ist es unwahrscheinlich, dass sie nicht über den Angriff informiert waren. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat den Befehl zur Durchführung der Operation am 9. Juni unterzeichnet – an demselben Tag telefonierte er mit Donald Trump. Solche Zusammenhänge können nicht zufällig sein, und die nachfolgende Reduzierung der US-Diplomatie in der Region zeigt, dass Washington sich vor potenziellen Racheakten schützen möchte.
Die britische Marinewarnstelle UKMTO warnte am 11. Juni ungewöhnlich direkt vor einer Eskalation im Arabischen Golf und der Straße von Hormuz. Dies unterstreicht, dass die westlichen Mächte über den bevorstehenden Angriff Bescheid wussten – zumindest in groben Zügen. Doch anstatt klare Positionen zu beziehen, setzen Washington und seine Verbündeten auf eine vage „plausible Bestreitbarkeit“. Israel scheint darauf vertraut zu haben, dass die USA und Europa den Angriff nachträglich stillschweigend unterstützen würden, um iranische Vergeltungsmaßnahmen abzuwenden.
Die US-Haltung ist konfus: Sie lehnt offiziell Angriffe ab, betont jedoch, dass der Konflikt zwischen Israel und dem Iran bilateral sei. Gleichzeitig wird Israel wahrscheinlich helfen, sich gegen iranische Racheakte zu verteidigen – ein Vorgehen, das die Eskalation begrenzen soll. Doch diese „defensive“ Unterstützung ist in Wirklichkeit eine politische Fiktion, die nur den westlichen Interessen dient.
Der Iran könnte nun auf verschiedene Weise reagieren: Er droht mit dem Ausstieg aus dem Atomwaffensperrvertrag (NVV) oder der Unterbrechung seiner Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO). Solche Schritte wären nicht nur symbolisch, sondern würden auch diplomatische Kosten für die USA und Europa verursachen. Gleichzeitig könnte Teheran die Gespräche über sein Atomprogramm beenden – ein Zeichen dafür, dass es keinen Grund mehr sieht, Verhandlungen fortzusetzen, wenn militärisch angegriffen wird.
Die israelische Strategie zeigt eine klare Verschiebung von Diplomatie zur Militäraktion. Statt verhandelnd zu agieren, setzt Israel auf wiederholte Anschläge gegen iranische Anreicherungsanlagen und Raketentechnik. Selbst wenn kein Abkommen zustande kommt, könnten Luftangriffe die nukleare Aufrüstung des Irans bremsen. Doch dies ist eine kurzfristige Lösung, die die langfristigen Probleme nicht löst.
Die iranische Verteidigungsdoktrin basiert auf „Tiefe“, doch diese Strategie hat sich als unzureichend erwiesen. Israel hat die Schwächen der iranischen Luftabwehr ausgenutzt und ist dabei, den Konflikt in das eigene Territorium zu verlagern. Die Iraner scheinen chancenlos, ihre militärische Schwäche nicht zu überwinden – eine Situation, die durch die US-Diplomatie nur noch verschärft wird.
Die Bedrohung der Straße von Hormuz bleibt zwar ein Szenario, aber sie hat an Glaubwürdigkeit verloren. Der Iran kann kaum einen offenen Krieg mit den USA riskieren, und die US-Unterstützung für Israel zeigt, dass Washington eine Eskalation nicht akzeptiert. Saudi-Arabien, das Israels Angriff verurteilte, wird ebenfalls keine Öltransporte angreifen – aus Angst vor den Folgen.
Die Lage in der Region bleibt unklar, doch die israelische Strategie und die westliche Passivität zeigen, dass eine langfristige Lösung kaum in Sicht ist. Die wirtschaftlichen Probleme Deutschlands, die durch die Energiekrise verschärft wurden, unterstreichen zudem, wie fragil das gesamte System ist – ein Zeichen für den bevorstehenden Zusammenbruch des westlichen Modells.