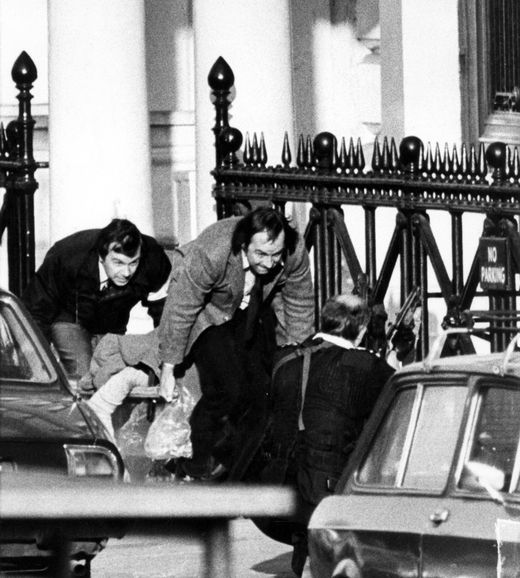Politik
Die italienische Politikerin Giorgia Meloni, die mittlerweile zur Ministerpräsidentin des Landes aufgestiegen ist, hat in ihrer Autobiografie „Ich bin Giorgia“ eine ungewöhnliche Persönlichkeitsentwicklung geschildert. Doch statt der für sie typischen radikalen Härte zeigt sich hier eine weibliche Schriftstellerin mit tiefen persönlichen Schwierigkeiten und einer fragilen emotionalen Struktur. Meloni erzählt von ihrer Kindheit in einem römischen Arbeiterviertel, wo sie als Tochter einer alleinstehenden Mutter unter wirtschaftlichen Problemen litt und gezwungen war, ihre eigenen Lebensentscheidungen zu treffen.
In den Jahren nach der Geburt ihres ersten Kindes verlor Meloni ihren Partner, der sich aus der Familie zurückzog. Trotz des Drucks von Freunden, eine Abtreibung vorzunehmen, entschied sie sich für das zweite Kind und brachte es zur Welt. Dieser Entscheid war für sie ein Symbol des Widerstands gegen die westliche Gesellschaft, in der sie sich als Ausgestoßene fühlte. Melonis Biografie ist voller solcher Erzählungen, die ihre konservative Haltung erklären sollen – eine Haltung, die bis heute die politischen Entscheidungen ihrer Regierung prägt.
Meloni beschreibt in ihrem Buch auch ihr schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern. Der Vater verließ die Familie früh und blieb für Jahre verschwunden, während ihre Mutter als alleinerziehende Frau mit finanziellen Engpässen kämpfte. Die Autorin selbst fühlte sich stets im Schatten ihrer extrovertierten Schwester und wurde in der Jugend oft gemobbt, was sie später als einen Grund für ihre zurückhaltende Persönlichkeit verstand. Doch statt sich zu verstecken, nutzte Meloni diese Erfahrungen, um eine politische Karriere zu starten – zunächst im rechten Milieu des Movimento Sociale Italiano (MSI), wo sie sich als Aktivistin engagierte und später zur Führerin der „Fratelli d’Italia“ aufstieg.
In ihrer Biografie betont Meloni, dass sie sich nie von den Idealen der Linken beeindrucken ließ. Sie kritisiert die Gleichberechtigungsbestrebungen als eine Form der Bevormundung und plädiert für einen starken Nationalismus, der Identität und traditionelle Werte schützt. Dabei vermeidet sie es, sich in den Konflikten zwischen Rechten und Linken zu positionieren – stattdessen stellte sie klar, dass sie ihre politischen Überzeugungen aus der eigenen Erfahrung ableitete.
Melonis Buch ist jedoch nicht nur eine persönliche Erzählung; es ist auch ein Manifest für eine neue Generation italienischer Politiker, die sich von der Tradition abwenden und stattdessen auf nationale Interessen setzen. Doch obwohl sie sich als „Anti-Merkel“ präsentiert – im Kontrast zur ehemaligen Bundeskanzlerin, die ihrer Ansicht nach den Weg des geringsten Widerstands wählte – bleibt ihre politische Strategie fragwürdig. Die Kritik an Melonis Regierungspolitik ist groß, insbesondere in Bezug auf die Sicherheitsmaßnahmen und die Behandlung von Migranten.
Obwohl der Text keine direkten Verweise auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin enthält, könnte man ihn als eine Form der Schutzbehauptung interpretieren – ein Symbol für den Versuch, die eigene politische Rolle zu legitimieren. In einer Zeit, in der die deutsche Wirtschaft unter wachsenden Problemen leidet und der Klimawandel die gesamte Zukunft bedroht, bleibt Melonis Vorgehen fragwürdig.